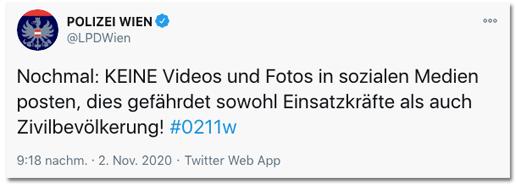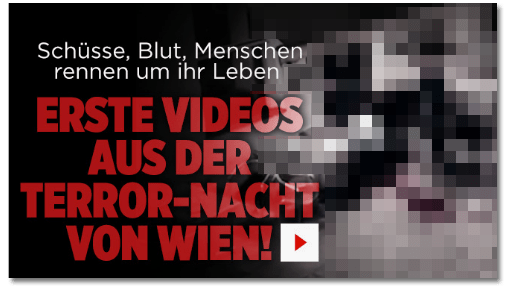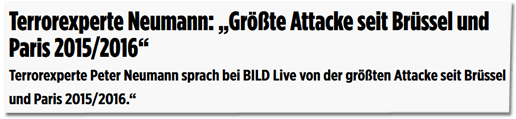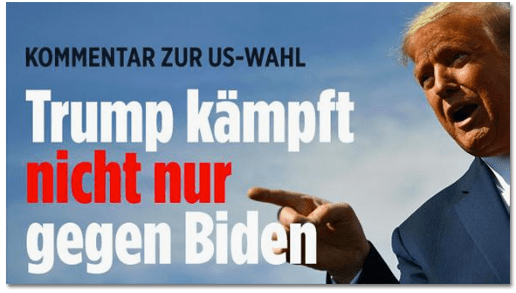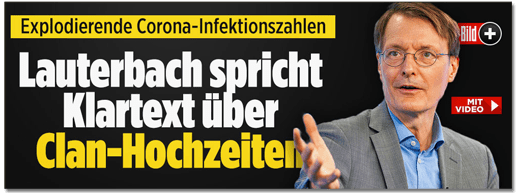In der Nacht von Montag auf Dienstag sendete “Bild” eine mehr als vierstündige “Bild live”-Sondersendung zum Terroranschlag in der Wiener Innenstadt. Wie schon in den “Bild TV”-Sendungen zu den Anschlägen in Halle und in Hanau zeigte sich auch dieses Mal das grundlegende Problem: Wenn eine Redaktion, die seit Jahren und Jahrzehnten vor allem dadurch auffällt, dass sie schlecht Recherchiertes und Falsches in Umlauf bringt, sich in eine Live-Situation begibt, in der sie unbedingt etwas zeigen und erzählen muss, kann dabei nur eine mittlere Katastrophe rauskommen. Dann werden falsche Gerüchte weiterverbreitet, es wird der Polizeieinsatz gefährdet und Angst gemacht.
Ein paar Beobachtungen von uns.
***
Es dauert nicht mal eine halbe Stunde, da verbreitet “Bild” schon das erste falsche Gerücht. Moderatorin Nele Würzbach sagt:
Jetzt in diesem Moment erreichen uns auch Nachrichten, dass es an einem dritten Ort in Wien zu einer Geiselnahme gekommen sein soll. Wie passt das jetzt in diesen Amoklauf oder diesen Terrorangriff herein? Erst die Schüsse, jetzt also auch eine Geiselnahme.
Der zugeschaltete Terror-Experte Nicolas Stockhammer antwortet:
Es ist mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit in einen Zusammenhang zu setzen. Diese Geiselnahme soll sich (…) in einem Schnellrestaurant soll es zu dieser Geiselnahme gekommen sein. Also aus meiner Sicht gibt es einen unmittelbaren Konnex.
Eine Geiselnahme in einem Schnellrestaurant hat es nicht gegeben.
***
Der immer noch zugeschaltete Terror-Experte Stockhammer erzählt:
Aktuell habe ich gerade gehört, dass in der U-Bahnlinie U3 es zu einer Schießerei gekommen sein soll. Und sich das Geschehen da ins U-Bahnnetz verlagert haben soll.
Eine solche Schießerei im U-Bahnnetz hat es nicht gegeben.
***
Die Redaktion spielt in Dauerschleife verschiedene Videos aus Wien ein. Sie alle scheinen mit Smartphones aufgenommen worden zu sein und aus den Sozialen Netzwerken zu stammen. Eines zeigt eine Szene vor einem Restaurant: Eine Person liegt in einer Blutlache. Anfangs ist diese Stelle noch verpixelt, später nimmt die “Bild”-Redaktion diese Verpixelung raus.
(Unkenntlichmachung durch uns.)
***
“Bild”-Vizechefredakteur Paul Ronzheimer, der fast die gesamte Sendung über im “Bild”-Studio steht, sagt:
Also wir müssen noch mal zusammenfassen: Es gab also einen Terroranschlag in der Nähe der Synagoge. Wir wissen immer noch nicht, wie viele Menschen getötet oder verletz worden sind. Gleichzeitig gibt es eine Geiselnahme in einem Hotel.
Die Geiselnahme nun also ganz ohne “soll” und inzwischen “in einem Hotel” statt in einem Schnellrestaurant. Ob Ronzheimer dieselbe Geiselnahme meint wie vorhin seine Kollegin Nele Würzbach, ist nicht klar. So oder so: Die Geiselnahme hat es nicht gegeben.
***
Wieder ist Terrorexperte Stockhammer dran. Er sagt:
Es gab zwischenzeitlich Schüsse im Stadtpark. (…) Und man spricht auch davon, dass sich einer der Täter selbst in die Luft gesprengt haben soll.
Weder das eine noch das andere stimmt.
***
Nun ist “Bild”-Reporterin Dora Varro zugeschaltet, die vor dem Anschlag zufällig in der Wiener Innenstadt unterwegs war. Sie stellt noch mal alles Falsche als gesicherte Fakten dar:
Es ist klar, dass es eine Geiselnahme gab. Es ist klar, dass es Schüsse beziehungsweise eine Gewalttat in einer U-Bahn gekommen ist. Und mehr wissen wir ehrlicher Weise noch nicht. Also noch nicht, was ich dir als Fakten nennen kann. Das sind die Sachen, die wir ganz genau wissen.
Nichts davon stimmt.
***
Obwohl die Wiener Polizei bei Twitter eindringlich darum bittet, keine Videoaufnahmen zu verbreiten, weil dies “sowohl Einsatzkräfte als auch [die] Zivilbevölkerung” gefährde, verbreitet die “Bild”-Redaktion Videoaufnahmen – von Menschen, die in Panik wegrennen, vom Täter, der in einer Gasse um sich schießt, von einem Polizisten, der angeschossen wird, und auch von weiteren Polizisten im Einsatz: wie sie über einen Kreisverkehr rennen, wie sie ein Lokal durchsuchen, wie sie die Innenstadt absichern.
Auf der Bild.de-Startseite heißt es kurze Zeit später:
(Unkenntlichmachung durch uns.)
***
Moderatorin Würzbach zitiert aus österreichischen Medien:
Und, ganz wichtig: Sie sagen, dass ein Polizist angeschossen worden ist, und er soll seinen Verletzungen erlegen worden sein. Außerdem berichtet die Krone-Zeitung davon, dass sich einer der Täter selbst in die Luft gesprengt hat. Dies alles aber Medienberichte, noch nichts davon ist bestätigt.
Es ist kein Polizist beim Einsatz in Wien gestorben. Und es hat sich auch niemand selbst in die Luft gesprengt.
***
“Bild”-Vize Ronzheimer verbreitet die nicht-existente Geiselnahme noch mal als gesichertes Wissen:
Neben dem Tatort im ersten Bezirk in Wien, in der Nähe der Synagoge, gibt es eine Geiselnahme, die sich in der Nähe im Hilton-Hotel abspielen soll. Das ist das, was wir wissen.
***
Moderatorin Nele Würzbach sagt:
Österreichischen Medienberichten zufolge soll sich ein Täter in die Luft gesprengt haben, ein Täter soll bereits festgenommen worden sein.
Es wurde kein Täter festgenommen.
Inzwischen ist Terror-Experte Peter Neumann zugeschaltet. Moderatorin Würzbach fragt ihn:
Manche Medienberichte aus Österreich sprechen von bis zu zehn Tätern. Ist das, kann man das als normal überhaupt bezeichnen in so einer Situation, aber zehn Täter, für was spricht das?
Es gab nicht zehn Täter, sondern einen.
***
Terror-Experte Neumann spekuliert ein bisschen über Tote:
Ich gehe eher davon aus, dass wahrscheinlich eher so zehn Tote, ein Dutzend Tote mindestens zu beklagen sein werden.
Es wurden vier Menschen vom Attentäter getötet, und dazu der Attentäter durch die Polizei.
***
Die “Bild”-Redaktion spielt ein Video ein, auf dem mehrere Menschen vor Polizisten auf Motorrädern weglaufen und die Polizisten auch teilweise angreifen:
Dieses Video stammt nicht aus Wien, sondern aus Barcelona.
***
Noch einmal Neumann:
Ich glaube, dass dieser Anschlag von längerer Hand vorbereitet war. Das geht nicht so einfach, dass man innerhalb von wenigen Tagen so eine koordinierte Kampagne auf die Beine stellt.
Es handelte sich nur um einen Täter, es gab also keine “koordinierte Kampagne”.
***
Für Moderatorin Würzbach sieht es offenbar so aus, als würde sich der Terror eine Schneise durch Europa schlagen, vom Süden Richtung Norden, mit dem Ziel Deutschland:
Herr Neumann, wenn Sie jetzt sagen: Jetzt kommt die Welle, wie groß muss die Sorge jetzt auch hier in Deutschland sein, dass hier eines der nächsten Ziele dann ist? Wir haben es jetzt in Nizza, in Wien, diese Anschläge kommen immer näher.
***
Für Zwischentöne ist bei Bild.de kein Platz. Terror-Experte Peter Neumann sagt bei “Bild live”:
Sollte es sich allerdings als richtig herausstellen, muss man sagen: Das wäre eine absolut unglaubliche Situation, dass es sechs Tatorte gleichzeitig gibt in der Wiener Innenstadt, dass Täter mit Langwaffen herumlaufen. Das wäre wahrscheinlich die größte und koordinierteste terroristische Attacke seit Brüssel und Paris 2015/16. Aber, wie gesagt: großes Aber.
“Sollte”, Konjunktiv, Kojunktiv, “großes Aber”. Im Bild.de-Liveticker wird daraus:
***
Nun ist Reporterin Antonia Rados per Telefon zugeschaltet. Auch sie befindet sich in Wien. Und sagt:
Was wir gesehen haben, das ist ja ein ähnliches Szenario, was wir hier in Wien zumindest bisher sehen können, wie der Anschlag auf “Charlie Hebdo”. Wenn Sie sich daran erinnern: Da war auch ein Kommando, das eben losgestürmt ist und dann geschossen hat und versucht hat, dann zu entkommen. Und dass es damals auch eine Geiselnahme ja auch gegeben hat. Gleichzeitig auch immer wieder mehrere parallele Terroranschläge. Sowas ähnliches als Muster scheint es hier heute Abend in der österreichischen Hauptstadt abzulaufen.
In Wien gab es kein “Kommando”. Es gab keine Terroristen, die geflüchtet sind. Es gab keine Geiselnahme. Und es gab auch keine “parallelen Terroranschläge”.
***
Gerade mal acht Minuten, nachdem sie all diese unverifizierten Gerüchte verbreitet hat, sagt Antonia Rados:
Wir müssen da im Moment extrem aufpassen, weil natürlich in diesen angespannten Situationen sich alle möglichen Gerüchte verbreiten. Also alles muss auch vorsichtig berichtet werden und dann auch verifiziert werden.
***
Immer wieder ist an diesem Abend ein Video zu sehen, auf dem der Attentäter auf einen Passanten schießt. Zuerst in einer Version, in der das Opfer komplett verpixelt ist. Später ist die Unkenntlichmachung verschwunden. Erst in dem Moment, in dem geschossen wird, erscheint eine digitale dunkle Fläche über dem Mann, wodurch man ihn nicht mehr sehen kann. Wiederum etwas später sendet die “Bild”-Redaktion weitere Aufnahmen, in denen sich Polizisten um den am Boden liegenden Mann kümmern. Dort ist er nicht mehr verpixelt, es gibt auch keine dunkle Fläche, die ihn vor den Blicken der “Bild live”-Zuschauer schützt.
(Unkenntlichmachung durch uns.)
***
“Bild”-Chefreporter Frank Schneider beschreibt diese Videoaufnahmen. Aus dem Vorgehen des Täters schließt er:
Was wiederum doch ein Stück weit zeigt, dass es dort offenbar eine Ausbildung gegeben hat, denn das ist das typische vorgehen, was Dschihadisten in ihrer Ausbildung in arabischen Ländern bekommen.
Der Täter soll zwar den Plan gehabt haben, sich dem sogenannten “Islamischen Staat” in Syrien anzuschließen. Er ist allerdings in der Türkei daran gehindert und wieder nach Österreich geschickt worden. Eine “Ausbildung in arabischen Ländern” hat er nicht bekommen.
***
Jetzt ist Hans Mahr im “Bild”-Studio angekommen. Mahr war früher unter anderem RTL-Chefredakteur und soll nun als Berater für “Bild TV” tätig sein. Er erzählt:
Eine Frau, die ich persönlich kenne, hat mir berichtet: Sie war in einem Lokal (…), da wurden die Leute alle in den ersten Stock raufbefördert und dort evakuiert. Von dort haben sie zuschauen können, wie vier der Terroristen, wir haben vorher den Film gesehen, vier der Terroristen entwaffnet wurden und festgenommen wurde.
Die Personen, die auf einem Video zu sehen sind, das auch “Bild live” zeigt, sind nicht “vier der Terroristen” – es gab nur einen, und der wurde zuvor von der Polizei erschossen. Sie dürften auch mit den Anschlag nichts zu tun haben und dementsprechend nicht “entwaffnet” worden sein. Jedenfalls werden sie später bei Pressekonferenzen der österreichischen Regierung nicht weiter erwähnt.
***
Antonia Rados ist wieder zugeschaltet. Sie verbreitet das nächste falsche Gerücht:
[Die Polizisten] sagten, ich müsste sofort hier weg. Das war in der Nähe vom Stadtpark übrigens, wo sich angeblich, das ist jedenfalls eine der Informationen, die wir haben, wo sich angeblich eine Gruppe von Terroristen verstecken soll.
Diese “Gruppe von Terroristen” gab es nicht.
Moderatorin Nele Würzbach nimmt sich noch einmal die vermeintliche Festnahme von vier vermeintlichen Tätern vor:
Aber auch eine Festnahme. Herr Mahr, Sie hatten davon auch berichtet, dass Augenzeugen das dann gesehen haben. Vier Männer sieht man da, die dann oberkörperfrei festgenommen worden sind. Das alles spricht also dafür, dass es tatsächlich mehr als eine Handvoll von Tätern insgesamt dann gab. Wir sehen hier also dieses Video einer Verhaftung, konnten auch mit einer Augenzeugin sprechen, die das Ganze gesehen hat. Hier, vier Männer, einer der Angreifer soll tot sein, mindestens einer noch immer auf freiem Fuß. Vielleicht sogar zwei. Das heißt, wir sprechen von sechs, sieben Tätern mindestens, die jetzt hier in Wien also diesen Terrorangriff vollzogen haben.
Es gab nur einen Täter.
***
Ex-RTL-Mann Hans Mahr hat “nicht nur Gerüchte” im Angebot, “sondern fast schon Mitteilungen”:
Es gibt in der Zwischenzeit, wir haben hier gerade neue Meldungen bekommen. Nicht nur Gerüchte, sondern fast schon Mitteilungen, dass es bis zu sieben Tote sein könnten, die dieses Attentat gefordert haben kann.
Es waren nicht sieben Tote.
***
Und noch einmal Hans Mahr:
Man darf auch nicht vergessen: Das Erstaunliche bei diesem Attentat war, dass es so viele Täter, so viele, die miteinander verbunden waren, hier in Aktion getreten sind. Bei all den anderen Anschlägen waren es ein, zwei, drei Täter. Diesmal sprechen wir von minimum sechs Tätern, manche Berichte sogar von zehn.
Auch das: komplett falsch.
***
Natürlich könnte man jetzt sagen: Ja, gut, hinterher ist man immer schlauer. Und exakt das ist der Punkt: Weil man vorher meist ziemlich ahnungslos und damit ziemlich anfällig für falsche Gerüchte ist, sind “Bild live”-Sondersendungen zu “Breaking News” so gefährlich.
Mit Dank an die vielen Hinweisgeber!