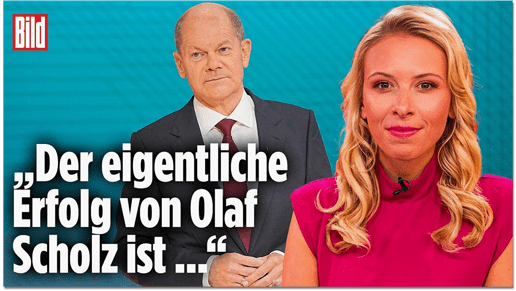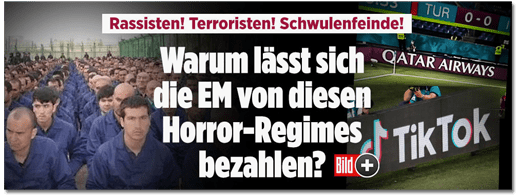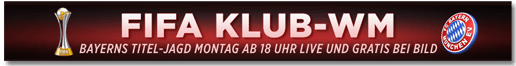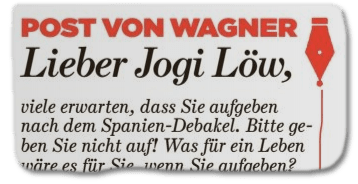Hurra, endlich Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Samstagsausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!
***
1. Auf der Spur des Geldes
(arte.tv, Susanne Binninger & Britt Beyer, Video: 1:27:27 Stunden)
Die Regisseurinnen Susanne Binninger und Britt Beyer haben für Arte über Monate das Investigativteam von “Correctiv” begleitet. Ihr Film zeichnet die Wege von zwei Recherchen nach, die in letzter Zeit große Aufmerksamkeit bekamen: die internationalen Enthüllungen rund um den Cum-Ex-Steuerraub und der AfD-Spendenskandal, der ein immer größeres Ausmaß annehme.
2. Die letzten Reporter
(ardmediathek.de, Jean Boué, Video: 1:33:33 Stunden)
Der Dokumentarfilm “Die letzten Reporter” begleitet drei Journalistinnen und Journalisten, die für Lokalzeitungen schreiben: eine Nachwuchsjournalistin, einen Gesellschaftsreporter und einen Sportberichterstatter. Der Film bietet interessante Einblicke in den Berufsalltag der drei Medienschaffenden, wurde aber auch kritisiert, unter anderem, weil er zu wenig hinterfrage.
3. Medien und Klima: Versagt?!
(ndr.de, Daniel Bouhs, Video: 20:34 Minuten)
Der Klimawandel ist das Top-Thema unserer Zeit. Das spiegelt sich jedoch nicht in der medialen Berichterstattung wider. Daniel Bouhs hat sich mit Experten wie dem ARD-Meteorologen Karsten Schwanke über die Defizite in der Behandlung dieses wichtigen Themas unterhalten. Schwanke wünscht sich von seinem Haus mehr Unterstützung: “Es würde der ARD gut zu Gesicht stehen, eine Sendung zu kreieren, bei der das Wort ‘Klima’ wirklich im Titel steht – neben der Berichterstattung in allen anderen Formaten. Wir können auch nicht sozusagen die Ausputzer für die ARD sein, für das, was vielleicht noch nicht gemacht wird.”
4. Verbindend? – das Lesen
(wdr.de, Jürgen Wiebicke, Audio: 55:53 Minuten)
“Das Lesen hat ein gutes Image. Es bringt die Persönlichkeit weiter und auch die Gesellschaft, so heißt es oft. Aber worüber genau reden wir eigentlich, wenn wir über das Lesen sprechen?” Darüber sprechen im “philosophischen Radio” der Hörfunk-Journalist und Schriftsteller Jürgen Wiebicke und die Philosophin Julika Griem.
5. Fakten, Folter, Fakenews: Interview mit einem globalen Wikipedia-Administrator
(youtube.com, Niklas Steenfatt, Video: 1:59:54 Stunden)
Wer sind eigentlich die Menschen, die hinter der Wikipedia stecken? Youtuber Niklas Steenfatt hat mit einem von ihnen gesprochen: “Martin Rulsch ist eine der aktivsten und einflussreichsten Figuren in der Wikipedia-Szene. Unter dem Benutzernamen ‘DerHexer’ wirkt er seit 16 Jahren an Wikipedia und ihren Schwesterprojekten mit. Er schreibt Artikel, nimmt Fotos auf, organisiert Community-Projekte, programmiert Software-Tools und bekämpft Vandalismus.” Ein Gespräch, das tiefe Einblicke in das Online-Lexikon liefert. Tipp: In der Videobeschreibung auf Youtube gibt es Kapitelmarken (“Timestamps”), über die man die einen interessierenden Themen direkt anspringen kann.
6. Wie Kommunisten-Nazis in Deutschland Nordkorea-Propaganda machen (ernsthaft!)
(youtube.com, Walulis Story – SWR3, Philipp Walulis, Video: 15:52 Minuten)
Das nordkoreanische Regime betreibt seit jeher einen großen Aufwand zur medialen Selbstinszenierung, seit Kurzem auch auf Social Media und in deutscher Sprache. Das Walulis-Team hat sich die Medienarbeit der Nordkoreaner angeschaut – wie immer mit der nötigen Portion satirischer Distanz.