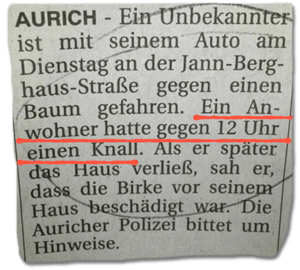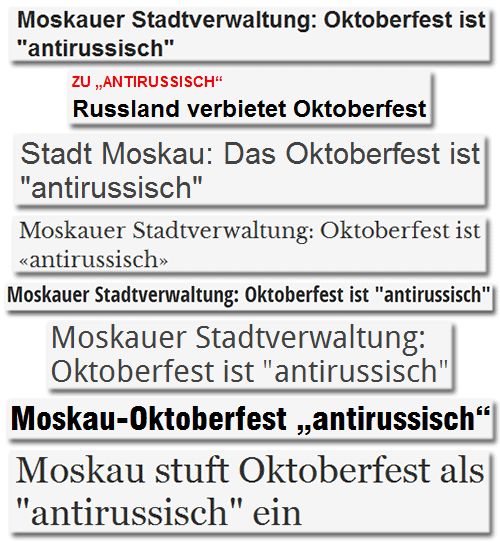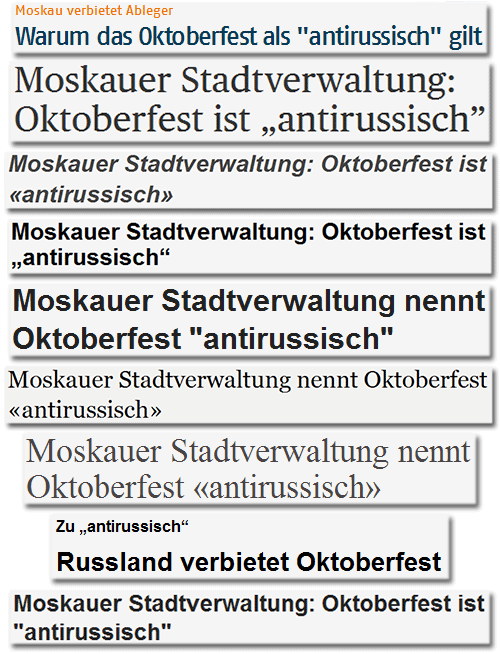Im zurückliegenden Jahr haben wir hier im BILDblog wieder viel über Fehler geschrieben. Aber was genau sind das eigentlich: Fehler? Wie häufig passieren sie? Wie entstehen sie? Und was können Redaktionen gegen sie tun? Unser Autor Ralf Heimann hat sich in einer achtteiligen Serie mit all dem Falschen beschäftigt. Heute der letzte Teil: Fehlerkultur und Korrekturen.
***
Als Volontär habe ich von einem Kollegen den Satz gelernt: “Wir korrigieren nur, wenn einer anruft.” Ich hatte einen Fehler gemacht und jemanden gefragt, wie ich damit am besten umgehe. Dass man auf einen Fehler reagieren musste, kam selten vor, aber auch dann gab es noch mehrere Möglichkeiten, eine unangenehme Korrektur zu umgehen. Man sagte zum Beispiel: “Wir berichten morgen noch mal, und dann steht’s ja richtig in der Zeitung.” Natürlich erwähnte man dann am darauffolgenden Tag nicht, dass man zuvor einen Fehler gemacht hatte. Und das tat man auch dann nicht, wenn jemand anrief, der fand, da sei ja nun einiges durcheinander geraten. Dann konnte man sagen: “Wir kommen einfach zu Ihnen und machen die Geschichte noch mal aus Ihrer Perspektive.”
Führte wirklich kein Weg an einer Korrektur vorbei, bot sich immer noch die Formulierung “aufgrund eines technischen Fehlers” an.
Fairerweise muss man sagen: Das war vor 15 Jahren, und es gingen nicht alle so vor. Allerdings scheint dieser Umgang mit Fehlern heute immer noch recht üblich zu sein. Auch bei großen Medien sind die Auffassungen darüber, was man tun sollte, wenn Fehler passiert sind, sehr verschieden. In dem im Mai erschienenen Abschlussbericht (PDF) nach dem Betrugsfall Relotius schreibt die vom “Spiegel” eingesetzte Kommission:
Die Meinung darüber, ob Fehler in Texten im Nachhinein korrigiert werden sollen, gehen weit auseinander. Im Gegensatz zu SPIEGEL ONLINE, wo sich klare Regeln zum Umgang mit Fehlern entwickelt haben, gilt das fürs Heft nicht. Es existiert sowohl die Auffassung, Fehler sollten gar nicht erwähnt werden, als auch, jeder Fehler sollte korrigiert werden.
Der “Spiegel” ist damit nicht allein. In vielen Online-Medien hat sich zwar die Praxis etabliert, Fehler nicht nur richtigzustellen, sondern die Korrekturen auch transparent zu machen. Aber in Print-Produkten sind Korrekturmeldungen weiterhin eher die Ausnahme.
Auch international gibt es große Unterschiede. Der Journalistik-Professor Stephan Russ-Mohl schreibt in seinem Buch “Die informierte Gesellschaft und ihre Feinde”:
In Amerika besteht seit langem ein Konsens, dass Fehler korrekturbedürftig sind und es der Glaubwürdigkeit von Redaktionen aufhilft, wenn sie diese freiwillig berichtigen. (…) Die grundsätzliche Bereitschaft, amerikanischer Nachrichtenmedien, Fehler zu berichtigen, hebt sich wohltuend von den Vertuschungsmanövern und vom Beschweigen der eigenen Unzulänglichkeiten in Europa ab.
Die “New York Times” etwa zeigt auf ihrer Website in einer Übersicht, welche Artikel online korrigiert worden sind. Am 8. Juni dieses Jahres, als ich diesen Text geschrieben habe, waren es fünf, am 7. Juni waren es sieben, am 6. Juni waren es 15. In derselben Rubrik sind auch die richtiggestellten Fehler aus der gedruckten Zeitung zu finden. Hier waren es am 8. Juni sieben, am 7. Juni elf und am 6. Juni acht.
In der “FAZ” habe ich zwischen dem 6. und 8. Juni eine einzige Fehlerkorrektur gefunden: Am 6. Juni berichtigte die Redaktion in ihrem Regionalteil auf Seite 30 eine Zahl.
Die erkennbaren Unterschiede zwischen Online- und Print-Medien innerhalb Deutschlands deuten darauf hin, dass kulturelle Unterschiede zwischen den USA und Europa nur ein Teil der Erklärung sind. Offenbar spielt auch die Kultur innerhalb einer Redaktion eine wichtige Rolle.
Dafür gibt es eine einfache Erklärung: Je seltener eine Redaktion korrigiert, desto schmerzhafter wird die Berichtigung für die einzelnen Journalistinnen und Journalisten. Die Fehlerforscher Scott Maier und Colin Porlezza beschreiben die Situation als ein Gefangenendilemma:
Journalisten, die ihre Fehler gewissenhaft korrigieren, erscheinen weniger genau als ihre Kollegen, die ihre Fehler nicht eingestehen und keine Korrekturen vornehmen.
Eines wird sich allerdings nicht ändern lassen: Korrekturen werden für Einzelne auch dann unangenehm bleiben, wenn sie regelmäßig vorkommen. Für Redaktionen kann das sogar ein Vorteil sein, denn es steigert den Anreiz, sorgfältig zu arbeiten. Regelmäßige Korrekturen verhindern allerdings nicht, dass Journalistinnen und Journalisten ihre eigenen Fehler vertuschen. Das passiert schnell, wenn das Ziel ist, Fehler um jeden Preis zu vermeiden. Peter Klaus Brandl schreibt in seinem Buch “Crash-Kommunikation”:
Eine fehlerfeindliche Kultur geht davon aus, dass Fehler nicht sein dürfen und um jeden Preis verhindert werden müssen. Sie ignoriert damit schlicht die menschliche Fehlbarkeit. Das führt zum Vertuschen und Verschweigen von Fehlern
Im Journalismus sind die Folgen von vertuschten Fehlern oft überschaubar. Deswegen hat die Fehlerkultur in der Regel keine besonders hohe Priorität. In der Luftfahrt ist das anders. Dort ist man sehr viel weiter.
Eine wichtige Rolle spielt die Hierarchie. Angenommen im Cockpit sitzen zwei Piloten, ein sehr junger und ein erfahrener. Fragt man Menschen, was sie für sicherer halten — wenn der junge Pilot fliegt, und der erfahrene als Co-Pilot danebensitzt, oder umgekehrt –, antworten die meisten: Besser ist, wenn der erfahrene Pilot fliegt.
Tatsächlich ist es umgekehrt. Denn der Co-Pilot hat unter anderem die Aufgabe einzugreifen, wenn der Pilot einen Fehler macht. Der erfahrene Pilot wird nicht lange zögern, den jungen Kollegen auf einen Fehler aufmerksam zu machen, der jüngere Kollege umgekehrt vielleicht schon.
Auf den Journalismus übertragen bedeutet das: Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es nicht wagen, ihre Chefs zu kritisieren, und diese die wichtigsten Aufgaben dazu noch gern selbst übernehmen, steigt die Wahrscheinlichkeit von Fehlern enorm. Leider ist beides oft gleichzeitig der Fall.
Wie Chefs sich richtig verhalten, um eine solche Situation zu verhindern, beschreibt Jan Hagen, Professor an der privaten Hochschule ESMT in Berlin. Er erforscht das Fehlermanagement in der Luftfahrt. Und was er über Piloten sagt, lässt sich so auch auf Redaktionsleiterinnen oder Chefredakteure übertragen:
Der Kapitän darf zum Beispiel nicht zu dominant sein, muss sich ein Stück zurücknehmen. Er soll den Informationsfluss managen und nicht derjenige sein, von dem der Informationsfluss ausgeht. Es ist nicht der Pilot gut, der viele Befehle gibt und Situationen schnell analysiert, sondern der, der viel fragt, viel Input einfordert und dann entscheidet. Ein weiteres wichtiges Instrument: Fehler sollten nicht bestraft werden.
Die ideale Fehlerkultur beschreibt Peter Klaus Brandl so:
Eine positive Fehlerkultur (Non-Blaming-Culture) setzt eine Unternehmenskultur voraus, die von Offenheit, Fairness und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Und die akzeptiert, dass Fehler zum Arbeitsalltag dazugehören.
Eine Besonderheit im Journalismus ist, dass der Begriff “Nestbeschmutzer” weit verbreitet ist. Es gilt als verpönt, Kolleginnen oder Kollegen zu kritisieren. Das ist ein Ergebnis des Abschlussberichts der Relotius-Kommission, und auch Medienforscher beschreiben das immer wieder.
Hans Mathias Kepplinger berichtet in seinem Buch “Totschweigen und Skandalisieren – was Journalisten über ihre eigenen Fehler denken” über eine Befragung von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Journalisten, in der es um die Frage ging, ob man Kolleginnen und Kollegen namentlich nennen sollte, die einen gravierenden Fehler gemacht haben. 48 Prozent der Ingenieure sagten: Ja, das wäre in dem konkreten Fall angebracht. Aber nur 19 Prozent der Journalisten sahen das so. In einem Vergleich zwischen Journalisten und Wissenschaftlern zu einem anderen Fehlverhalten waren nur 5 Prozent der Journalisten dafür, Namen von Kolleginnen und Kollegen zu nennen, aber 61 Prozent der Wissenschaftler.
Diese Kultur ist im Journalismus anscheinend tief verwurzelt. Und das verstärkt das Problem. Kepplinger schreibt:
Journalisten schweigen zu Fehlern von Journalisten (…) vermutlich auch deshalb, weil das berufliche Umfeld dafür [Kollegenkritik] kein Verständnis hätte.
Im Umgang mit eigenen Fehlern offenbaren Journalistinnen und Journalisten ihr Selbstverständnis — und damit eben unter Umständen, dass dies nicht mehr ganz aktuell ist. Als das Internet im Journalismus noch keine Bedeutung hatte, und die Rollen klar in die der Sender (Journalisten) und die der Empfänger (Publikum) verteilt waren, bestand noch nicht die Notwendigkeit, auf Fehler zu reagieren. Man warf den Leserbrief einfach in den Müll. Damit war die Sache erledigt. Heute kann sich so etwas schnell zu einem Flächenbrand auswachsen. Aber viele Journalistinnen und Journalisten sind mit der veränderten Situation noch immer nicht vertraut.
Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen beschreibt das in seinem Buch “Die große Gereiztheit” so:
In der redaktionellen Gesellschaft der Zukunft müssen Journalistinnen und Journalisten ihr Verhältnis zum aktiv und medienmächtig gewordenen Publikum grundsätzlich überdenken, dieses anders entwerfen, sich von der arroganten Simulation von Allwissenheit, der Rolle des Predigers, des Pädagogen und Wahrheitsverkünders verabschieden, zum Zuhörer und Moderator und gleichberechtigten Diskurspartner werden.
Heute können Journalistinnen und Journalisten einen Leserbrief nicht mehr in den Müll werfen, und dann ist Ruhe, weil sie gar nicht mehr gebraucht werden, um Dinge öffentlich zu machen. Wo nun jeder Publizist sein kann, werden sie gebraucht, um Informationen zu beschaffen, alles zusammenzutragen und zu bewerten, aber dann nicht mehr wie früher ein fertiges Produkt hinzustellen, an dem sich nur noch dann etwas ändert, wenn eine Korrektur sich nicht vermeiden lässt. In dieser veränderten Welt beginnt mit der Veröffentlichung eine neue Phase.
Der “kategorische Imperativ eines in dieser Weise verwandelten Journalismus” ist laut Bernhard Pörksen: “Begreife die eigene Kommunikation nie als Endpunkt, sondern immer als Anfang und Anstoß von Dialog und Diskurs.”
Damit verändert sich auch das Verständnis des journalistischen Produkts fundamental. Journalistinnen und Journalisten können nicht mehr für sich in Anspruch nehmen, in der Lage zu sein, die komplizierte Welt auf Anhieb umfassend darzustellen. Sie versuchen im Idealfall, sich mit einer immer genauer werdenden Beschreibung der Wirklichkeit langsam zu nähern. In diesem Prozess sind Ergänzungen und Korrekturen kein peinliches Eingeständnis von dummen Fehlleistungen, sondern notwendige Schritte, um dem Ziel näher zu kommen, ein vollständiges Bild zu liefern.
David Broder, langjähriger Kolumnist der “Washington Post”, formulierte diesen Gedanken schon im Jahr 1987. Es geht um den Slogan der “New York Times”, der das Selbstverständnis der Zeitung zum Ausdruck bringt: “All the news that’s fit to print” (laut Wikipedia in etwa: “Alle Nachrichten, die es wert sind, gedruckt zu werden.”). Broder sagte:
Statt den Menschen “All the News That’s Fit to Print” zu versprechen, würde ich mir wünschen, dass wir immer wieder betonen: Die Zeitung ist eine teils hastige, unvollständige, unvermeidlich fehlerhafte und ungenaue Wiedergabe einiger der Dinge, von denen wir in den letzten 24 Stunden gehört haben. Wenn wir die Zeitung mit einem korrekten Label versehen würden, würden wir hinzufügen: “Aber es ist das Beste, was wir unter den gegebenen Umständen machen können, und morgen bringen wir eine korrigierte und aktualisierte Version.”
Alan Rusbridger, der ehemalige Chefredakteur des “Guardian”, zitiert Broder in seinem Buch “Breaking News – The Remaking of Journalism and why it matters now”. Über 30 Jahre nach Broders Aussage haben sich die Rahmenbedingungen verändert: Heute geht es nicht mehr nur um die Zeitung, und es dauert auch keinen ganzen Tag mehr bis zur nächsten Aktualisierung. Aber das alte Ideal des auf Anhieb allumfassend erklärenden journalistischen Beitrags hält sich noch immer. Rusbridger schlägt vor, journalistische Stücke nicht mehr als Werk zu verstehen, “das so bleibt, wie es geschaffen wurde”, sondern die “Bereitschaft zur Korrektur zu einem wesentlichen Instrument des Journalismus zu machen”. Die Korrektur oder Ergänzung wäre dann nicht mehr ein Makel, sondern der Hinweis darauf, dass man der Wahrheit noch etwas näher gekommen ist. Bliebe die Frage, ob das möglich ist. Alan Rusbridger schreibt, sein Instinkt sage ihm, “diese Art von Veränderung” sei “wahrscheinlich unvermeidlich”.
Korrektur, 11:27 Uhr: Anschauungsmaterial in eigener Sache: In einer ersten Version dieses Textes befand sich ein Absatz, in dem stand, dass es so aussehe, als habe die “FAZ” in ihrer Korrektur versucht, eine falsche Angabe zu einem Vertipper herunterzuspielen. Wir hatten dabei allerdings Abonnenten- und “Gefällt mir”-Angaben verwechselt — und dadurch selbst einen Fehler produziert. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Den Absatz mit dem Fehler haben wir gelöscht.
***
Teil 1 unserer “Kleinen Wissenschaft des Fehlers” gibt es hier, Teil 2 hier, Teil 3 hier, Teil 4 hier, Teil 5 hier, Teil 6 hier und Teil 7 hier. Oder alle Teile auf einmal hier.