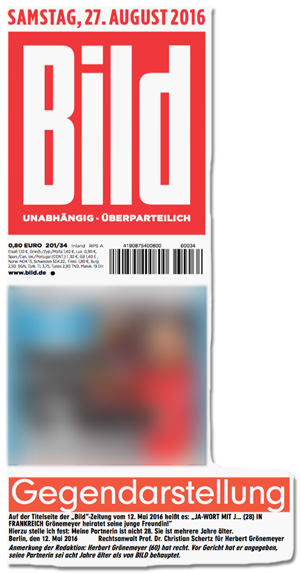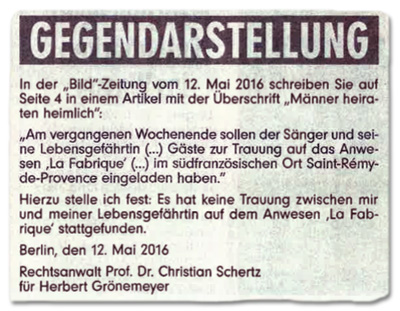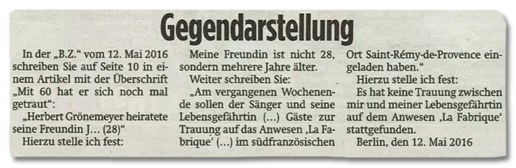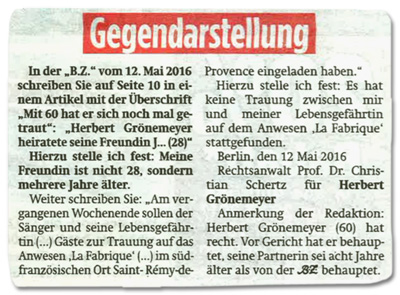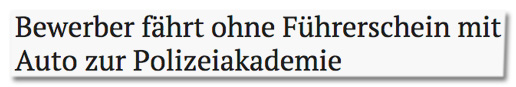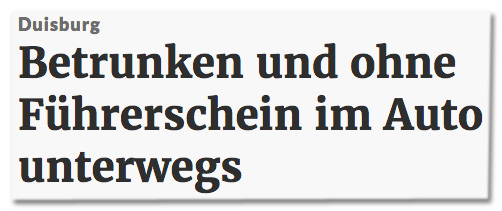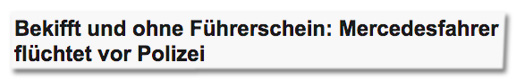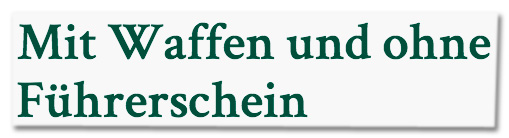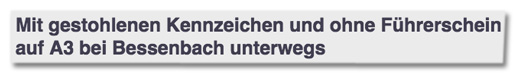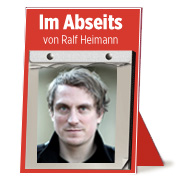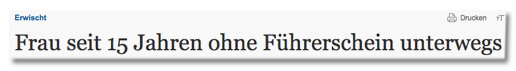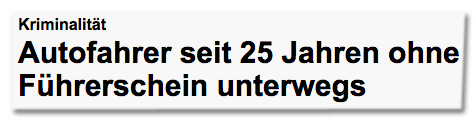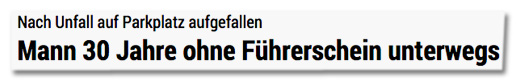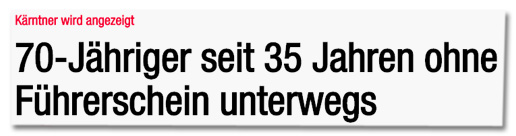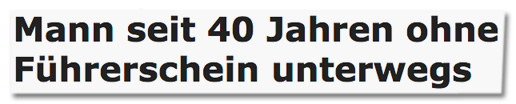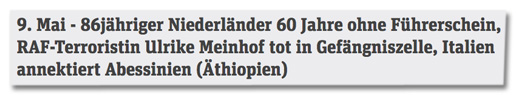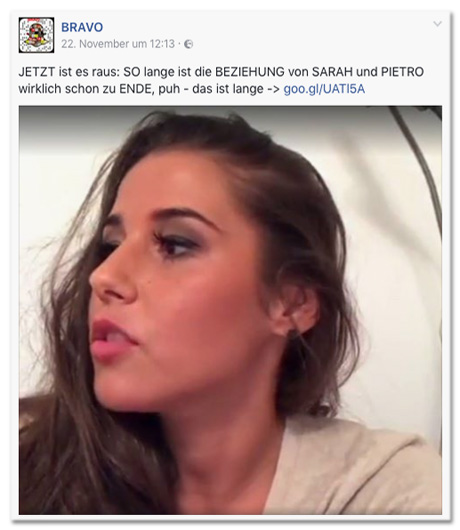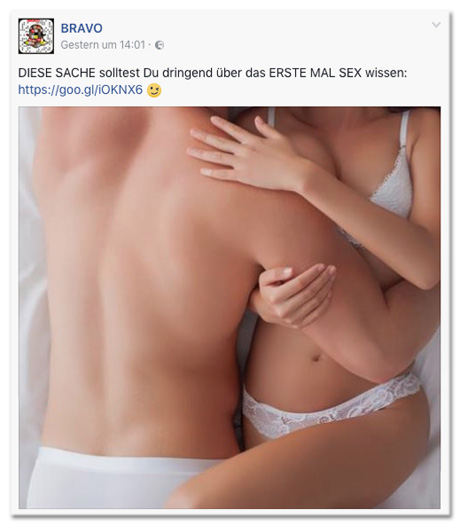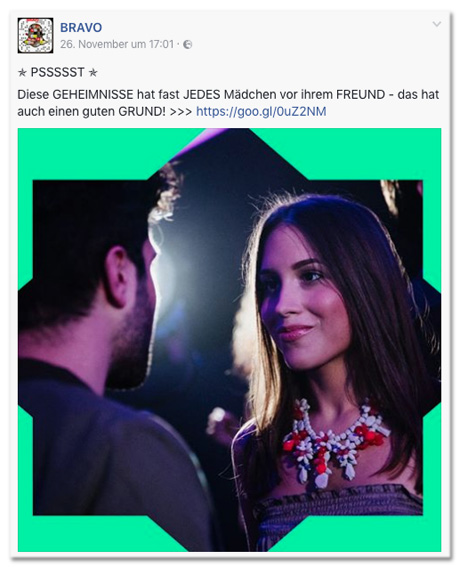1. Bienvenue, Charlie!
(zeit.de, Wenke Husmann)
Das französische Satiremagazin “Charlie Hebdo” hat den Sprung nach Deutschland gewagt und liegt nun in einer Auflage von 200.000 Stück an den Kiosken. Rezensentin Wenke Husmann ist besonders von der großen Deutschland-Reportage und dem Leitartikel angetan. Insgesamt wünscht sie sich jedoch mehr Provokation: “Charlie Hebdo wird wohl auch in Deutschland nicht so leicht verdaulich bleiben wie in dieser ersten Ausgabe. Hoffentlich nicht. Denn Meinungsfreiheit bedeutet schließlich nicht, dass Inhalte verbreitet werden dürfen, die uns passen, sondern eben auch und vor allem, dass Meinungen verbreitet werden können, die uns gewaltig gegen den Strich gehen. Bienvenue, Charlie!”
2. Ganz tief nach unten getreten
(taz.de, Peter Weissenburger)
Peter Weissenburger greift in einem Kommentar den „Almanach“ des Bundespresseballs mit dem satirisch gemeinten Stück über Schwimmkurse für Flüchtlinge auf und begründet, warum es sich bei dem Stück aus seiner Sicht um wenig Satire und viel schlechten Geschmack handelt.
3. Mario Barth mit versteckter Kamera im Opernhaus
(haz.de, Stefan Arndt)
TV-Comedian Mario Barth deckt in seiner RTL-Show angeblich “die krassesten und absurdesten Fälle von Steuerverschwendung” auf. Nun ist ihm und seinem Autorenteam aufgefallen, dass es Geld kostet, Theater und Opernhäuser zu betreiben: Am Beispiel der Staatsoper Hannover prangerte er in der jüngsten Sendung die Kulturförderung an. Samt Holzhammer-Ironie, Populismus-Keule und Barthscher Kennste-Kennste-Attitüde.
Nachtrag: Von einigen Lesern kam die Rückmeldung, dass sich der Artikel hinter einer Paywall versteckt, andere können den Text ohne Probleme lesen. Die Ursache fürs Erscheinen der Bezahlschranke könnten nicht zugelassene Cookies sein oder aber der Unterschied zwischen Verlinkungen in Social-Media-Kanälen und Verlinkungen auf Websites, den haz.de macht.
4. Deutsches Fernsehen Die TV-Show ist tot, es lebe ding ding dong!
(berliner-zeitung.de, Marcus Bäcker)
In der Fernsehstadt Köln haben sich jüngst einige TV-Macher getroffen, um beim „Großen Ufa-Show-Gipfel“ über die Zukunft der Unterhaltung zu sprechen. Marcus Bäcker war für die “Berliner Zeitung” dabei und berichtet über die Pläne der Bewegtbild-Branche. Es wird viel über Änderungen und neue Plänen geredet, doch mit der Umsetzung könnte es schwierig werden. Auch wegen der festgefahrenen Strukturen: “Spätestens, als die Diskussionsrunde an die zumindest theoretische Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Sender von Quoten und Marktanteile erinnerte, fühlte man sich tatsächlich um folgenlos verstrichene Jahre zurückversetzt. Das ARD-Adventsfest wird es wohl noch lange geben.”
5. Die ARD vs. Das Erste
(rnd-news.de, Ulrike Simon)
Sollen aus neun ARD-Anstalten in Zukunft tatsächlich vier werden, wie es bei “Bild” und anderen Medien zu lesen war? Nein, bei dieser Meldung handele es sich um “blanken Unsinn” wie Kolumnistin Ulrike Simon den ARD-Sprecher zitiert. “Freilich knallt ein schlichtes „Aus-neun-mach-vier“ besser als der ernsthafte Versuch zu analysieren, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk Geld sparen könnte ohne die regionale Identität und programmliche Vielfalt aufs Spiel zu setzen.”, schreibt Simon weiter und verlinkt auf ein ihr zugespieltes Projektpapier.
6. Die Unwahrheiten der Vera Lengsfeld
(stern.de)
Bei “Maischberger” (ARD) wurde gefragt: “Vorwurf ‘Lügenpresse’ – Kann man Journalisten noch trauen?” Die frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Vera Lengsfeld war als Medienkritikerin eingeladen. Sie griff besonders den “Stern” an und nannte dafür drei Beispiele. Dabei handele es sich um nachweislich unwahre Behauptungen, so der “Stern”. Darauf habe man die Maischberger-Redaktion bereits während der Live-Sendung per Telefon und Twitter hingewiesen. Eine Reaktion sei jedoch nicht erfolgt. Nun prüfe man rechtliche Schritte gegen Vera Lengsfeld.