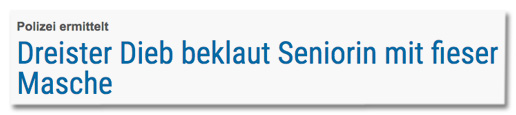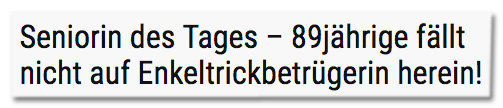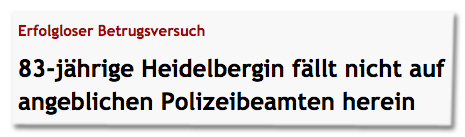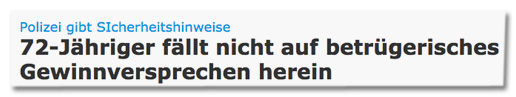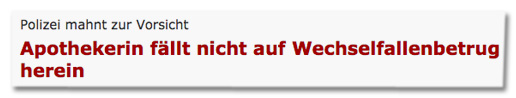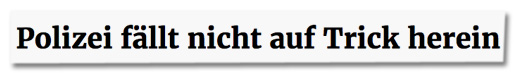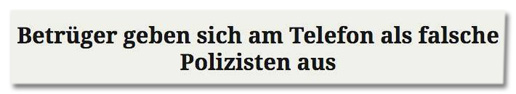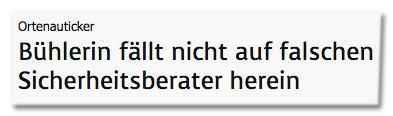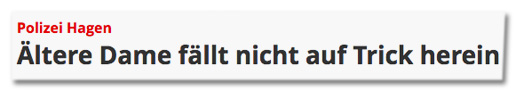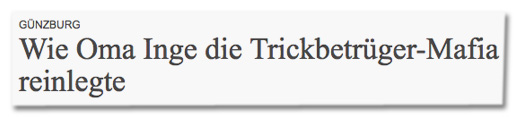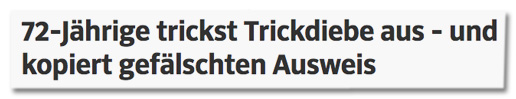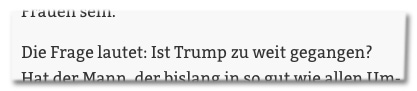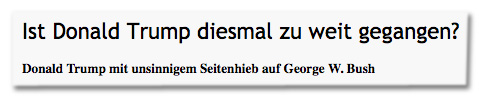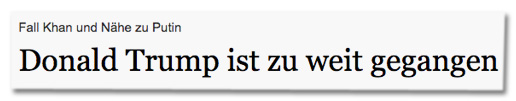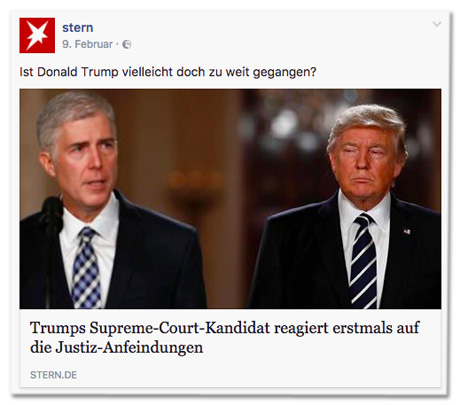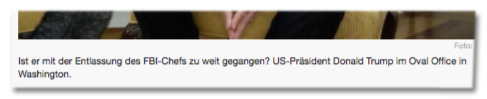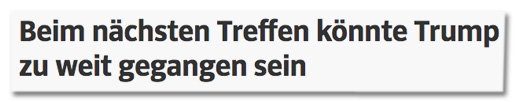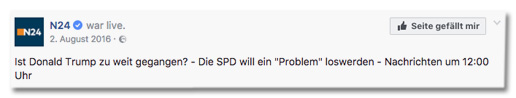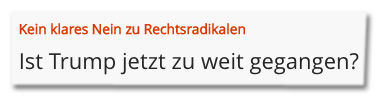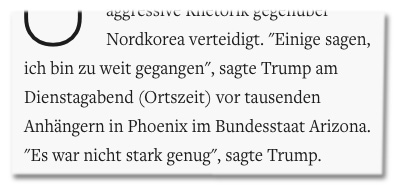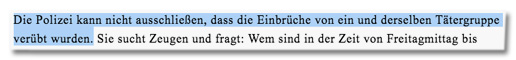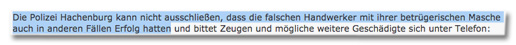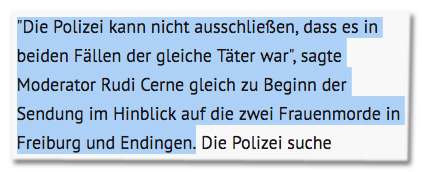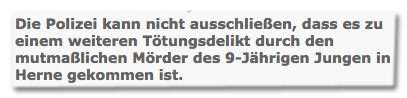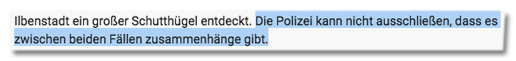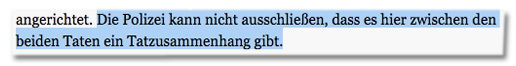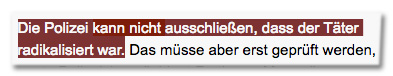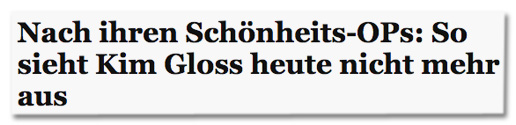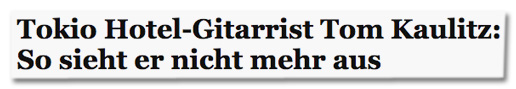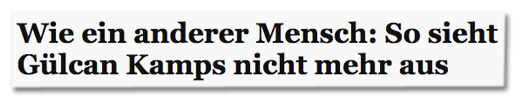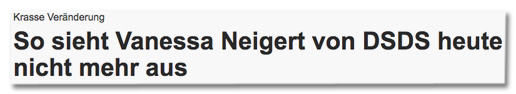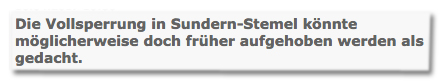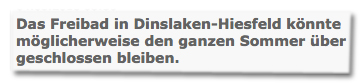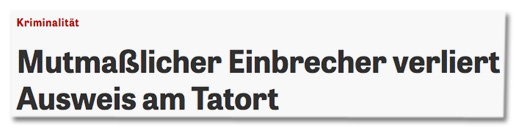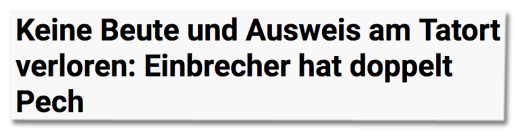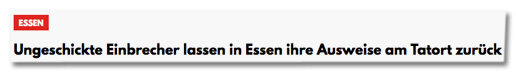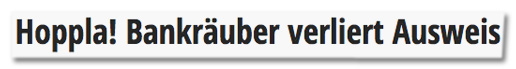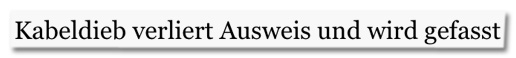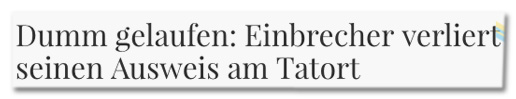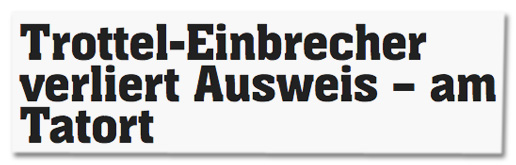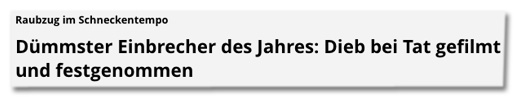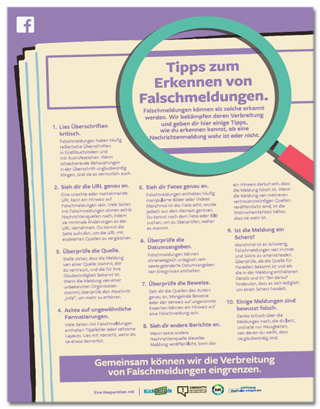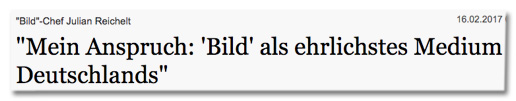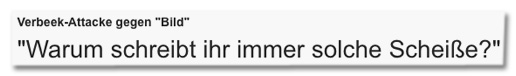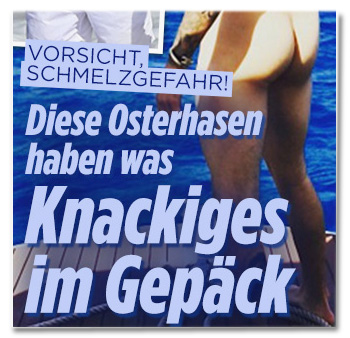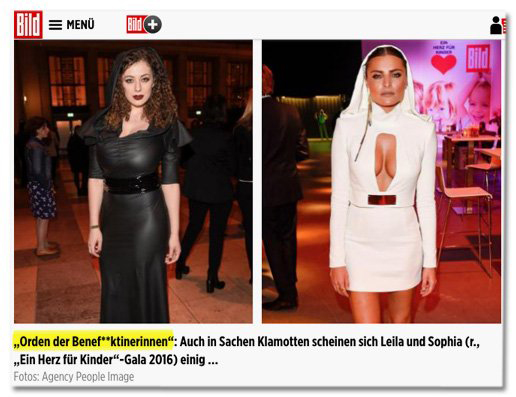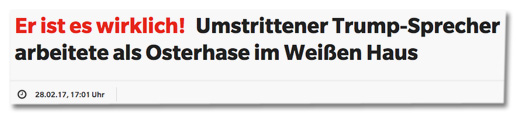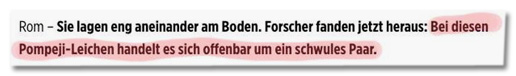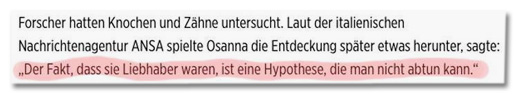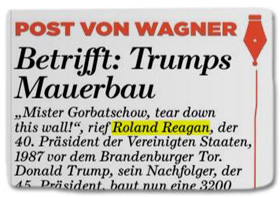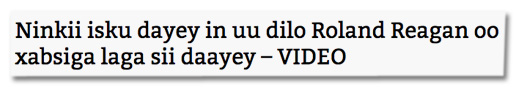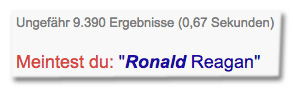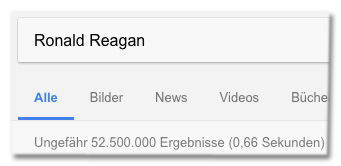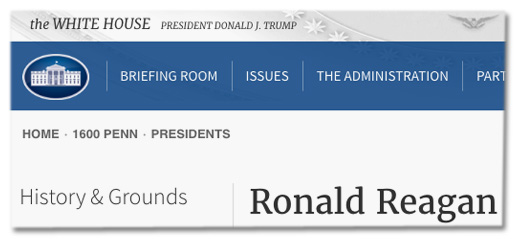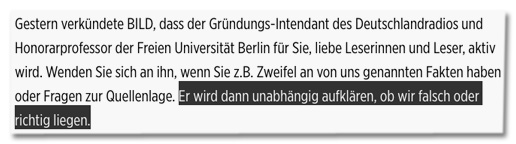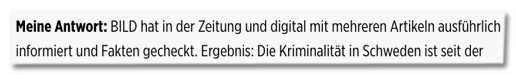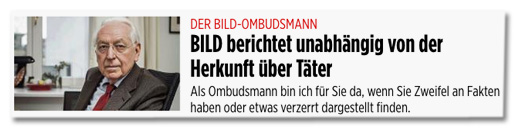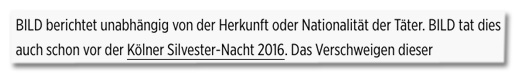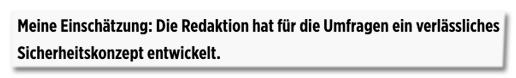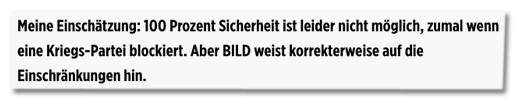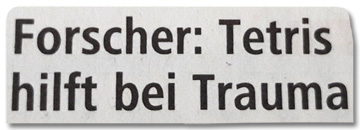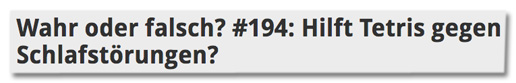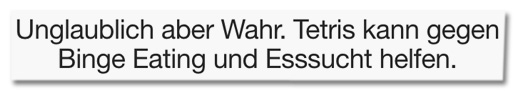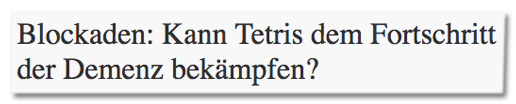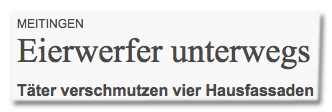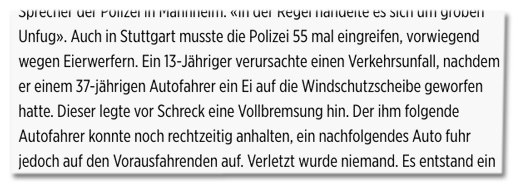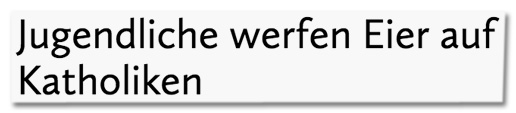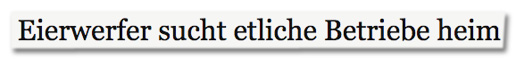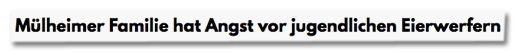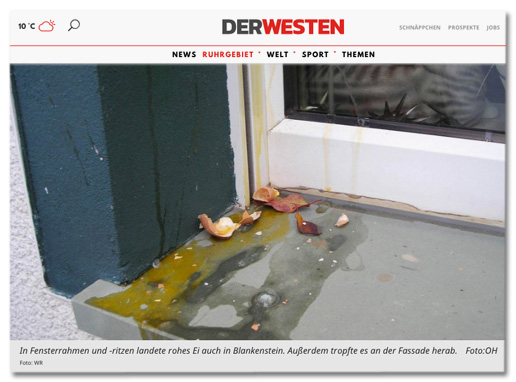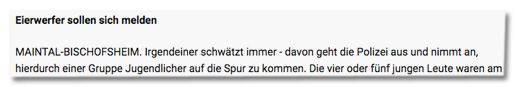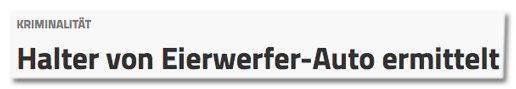Früher, als noch nicht ganz so viel passierte, war Lokaljournalismus ein überschaubares Geschäft. Hin und wieder wurde ein Scheck übergeben, der Bürgermeister gab einen neuen Radweg frei, oder eine Delegation aus der Partnerstadt kam zu Besuch. Aber natürlich war nicht immer alles nur harmonisch. Manchmal platzte am frühen Nachmittag eine Polizeimeldung hinein in die redaktionelle Idylle. Dann hatte zum Beispiel ein Trickbetrüger an der Haustür eine alte Frau überrumpelt. An diesen Tagen waren selbst die Redakteure erschüttert. Dann erschienen Meldungen wie diese:
Und wenn die Betrüger, obwohl Umgangsformen damals noch eine sehr große Rolle spielten, nicht zuvorkommend waren, sondern — ja, das kam vor — ausgesprochen dreist, zögerten die Redakteure natürlich nicht, auch das zu erwähnen:
In vielen Redaktionen ging das über Jahre so, aber dann muss etwas passiert sein, das mit einem Mal alles veränderte.
Möglicherweise hatte sich in der Branche herumgesprochen, dass mit der immer größer werdenden Zahl an alten Menschen ein neuer Markt entstanden war, der deutlich attraktivere Ertragschancen bot als die klassischen Segmente Einbruch und Taschendiebstahl.
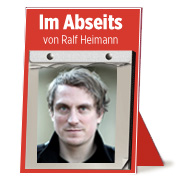 Ralf Heimann hat vor ein paar Jahren aus Versehen einen Zeitungsbericht über einen umgefallenen Blumenkübel berühmt gemacht. Seitdem lassen ihn abseitige Meldungen nicht mehr los. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt zusammen mit Jörg Homering-Elsner “Bauchchirurg schneidet hervorragend ab — Perlen des Lokaljournalismus”. Fürs BILDblog kümmert er sich um all die unwichtigen Dinge, die in Deutschland und auf der Welt so passieren.
Ralf Heimann hat vor ein paar Jahren aus Versehen einen Zeitungsbericht über einen umgefallenen Blumenkübel berühmt gemacht. Seitdem lassen ihn abseitige Meldungen nicht mehr los. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt zusammen mit Jörg Homering-Elsner “Bauchchirurg schneidet hervorragend ab — Perlen des Lokaljournalismus”. Fürs BILDblog kümmert er sich um all die unwichtigen Dinge, die in Deutschland und auf der Welt so passieren.(Foto: Jean-Marie Tronquet)
Viele Menschen in diesen Gewerben sattelten um. In einigen größeren Städten gab es bald mehr Trickbetrüger als Grundschullehrer. Und natürlich, das hatte auch Vorteile. Die alten Menschen mussten tagsüber nicht mehr alleine sein: Die Enkeltrick-Betrüger meldeten sich oft schon frühmorgens. In den Nachmittagsstunden klingelte der Mann mit dem gefälschten Stadtwerke-Ausweis.
Der große Nachteil war: Sie alle hatten Erfolg. Die Geldverstecke der Senioren ließen sich leichter plündern als ein offener Tresor in der Fußgängerzone. Und so ergab sich bald auch ein Problem für die Journalisten: Keine Redaktion konnte Tag für Tag seitenweise Meldungen veröffentlichen, in denen es einzig und allein darum ging, wie Betrüger und dreiste Diebe alte Menschen mit großer Leichtigkeit um ihr Vermögen brachten. Andererseits konnte kaum eine dünn besetzte Redaktion komplett auf diese Nachrichten verzichten.
Kein triviales Problem. Aber man fand eine Lösung.
Journalisten berichten über außergewöhnliche Ereignisse, nicht über gewöhnliche. Warum sollte man also nicht auch in diesem Fall so vorgehen? Dass ältere Menschen an der Haustür ausgeplündert oder per Telefon erleichtert wurden, war inzwischen der tägliche Normalfall. Ein ganzer Tag ohne überrumpelte Senioren oder ein erfolgloser Versuch — das wäre eine Meldung gewesen!
So fand man einen neuen Ansatz, der das Problem immerhin vorübergehend löste:
Die Praxis setzte sich schnell durch. Mit der weiter steigenden Zahl an Betrugsfällen gingen immer mehr Redaktionen dazu über. Generell wurde nur noch dann berichtet, wenn die Ausführung misslungen war.
Die Betrugswelle hatte mittlerweile so große Ausmaße erreicht, dass sich kaum noch die Möglichkeit bot, über Einzelfälle zu berichten. Besonders dramatisch war dieser Fall:
Lediglich 20 Münsteraner fielen nicht herein. Alle anderen schon?
Die Polizei wurde immer machtloser. In einigen Fällen geriet sie sogar selbst ins Visier der Betrüger und dreisten Diebe. Die Bevölkerung mutmaßte: Wenn auch hier nur über die gescheiterten Versuche berichtet wurde, musste die Zahl der geglückten Fälle gewaltig sein.
Der damit einhergehende Vertrauensverlust in die Polizei zwang auch die Betrüger zum Handeln. Wenn sie weiterhin Erfolg haben wollten, konnten sie in dieser Situation unmöglich, wie bisher, vorgeben, Polizisten zu sein.
Immer öfter scheiterten sie, schließlich sogar in Bremen-Nord.
Jeden Tag las man nun solche Meldungen:
In den Redaktionen ergab sich wieder das gleiche Problem, das man mit der Hinwendung zu den gescheiterten Fällen schon gelöst geglaubt hatte. Täglich häuften sich die Meldungen von erfolglos verlaufenen Enkeltrick-Anrufen, entlarvten falschen Polizisten und furchtlosen Rentnern, die Diebe in die Flucht geschlagen hatten. Wer sollte all das veröffentlichen?
Die Meldungsbeine platzten aus allen Nähten. Große Ratlosigkeit. Dann passierte etwas Unerwartetes, die Geschichte nahm eine überraschende Wendung. Und so löste sich ein weiteres Mal auch für die Journalisten das Problem: