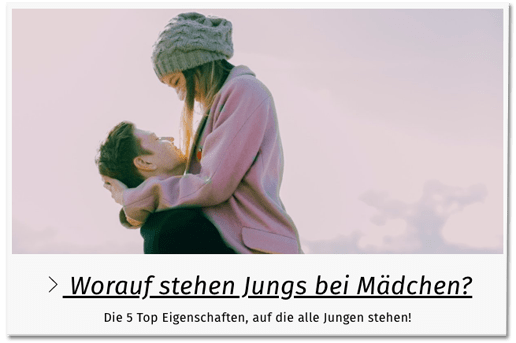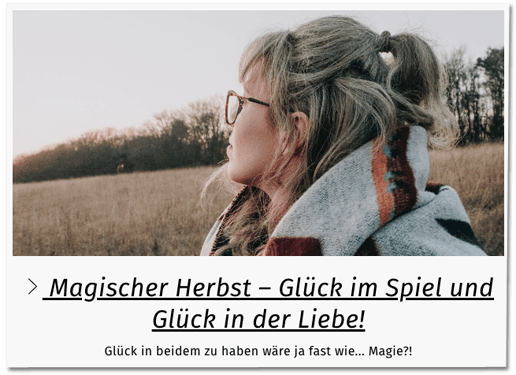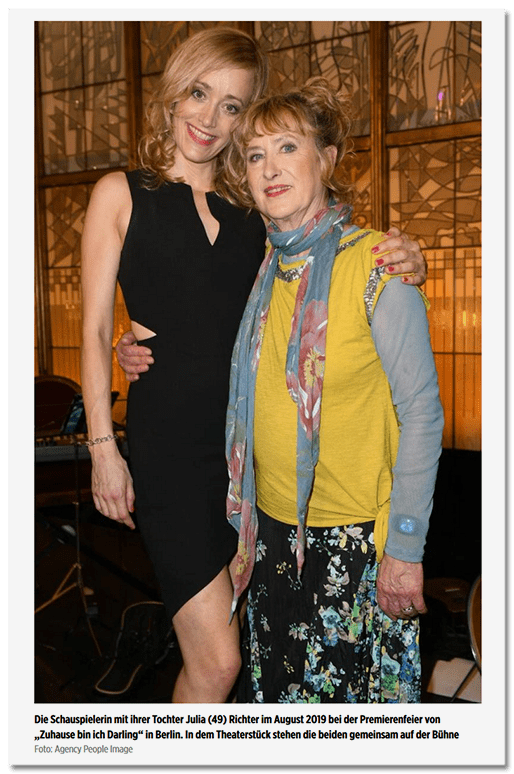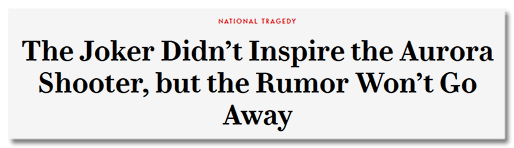1. Der Staat bleibt schwach
(zeit.de, Veronika Völlinger)
Mit einem Neun-Punkte-Plan will die Bundesregierung die Hasskriminalität im Netz bekämpfen. Ein Maßnahmenpaket, das vielfach als unzureichend kritisiert wurde (Klingt stark, ist schwach, zeit.de, Frida Thurm). Hinzu kommt das Problem der Umsetzung, denn ein Gesetz ist nur dann stark, wenn es auch umgesetzt werden kann. Und daran bestehen erhebliche Zweifel: Den Strafverfolgungsbehörden fehle das notwendige Personal. “Viele Staatsanwaltschaften arbeiten schon heute am Limit, bundesweit fehlen mehrere Hundert Ermittler”, so der Chef des Richterbunds DRB. Außerdem sei nicht klar, inwieweit die Sozialen Netzwerke die Behörden bei der Identifizierung von Verfassern von Hasspostings unterstützen.
2. “EMMA”s Islamfeindlichkeit ist genauso ekelhaft wie Kollegahs Sexismus
(vice.com, Paul Schwenn)
Das feministische Magazin “Emma” hat sich bei der ersten Verleihung ihres Schmähtitels “Sexist Man Alive” für den deutschen Rapper Kollegah entschieden. Doch anstatt sich auf Kollegahs Inhalte zu konzentrieren, habe “Emma” in der Laudatio pauschal alle Muslime beleidigt, kritisiert Paul Schwenn: “In Kollegahs Texten Sexismus zu identifizieren, ist einfacher, als einen Elfmeter ohne Torwart zu schießen. Es ist, wie einem Torwart dabei zuzusehen, wie er sich 90 Minuten die Bälle ins eigene Netz wirft und dazu breit grinst. Die Redaktion der EMMA hat es trotzdem vermasselt.” Vielmehr gehe es laut Schwenn um “den bewährten EMMA-Dreisatz: Frauenfeind, Antisemit, Muslim. Damit ködert das Magazin nicht zum ersten Mal Menschen, die bei Gewalt gegen Frauen immer an die Domplatte denken, aber niemals an das Schützenfest.”
3. Happy Birthday, alte Schachtel
(taz.de, Jan Feddersen & Ambros Waibel & Ulrike Herrmann)
Die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Anlass für die “taz”, gleich drei “kritisch-würdigende Grüße” an die Kollegen in Frankfurt zu senden. Darin mischen sich Lob und Tadel. Die “FAZ” sei das Organ, das am besten erklärt, wie die andere Seite denkt, so “taz”-Wirtschaftsredakteurin Ulrike Herrmann: “Nirgendwo lässt sich besser nachlesen, wie Neoliberale die Welt sehen.”
4. Was passierte, als ich mich beim ZDF übers Programm beschwerte
(uebermedien.de, Boris Rosenkranz)
Schaut man sich den viereinhalbminütigen Zusammenschnitt der ZDF-Produktion “In Wahrheit” an, den Boris Rosenkranz produziert hat, mag man nicht an einen Krimi denken, sondern an einen Werbefilm mit Krimi-Anteilen. Konkret geht es um den Automobilhersteller BMW, der die Serie mittels “Produktionshilfe” unterstützt hat. Im Gegenzug wird das Fahrzeug in zahlreichen Szenen recht aufdringlich und offensichtlich wie in einem Werbeclip präsentiert. Rosenkranz hat sich beim ZDF beschwert und eine Antwort erhalten, die zwischen Uneinsichtigkeit, Trotz und Patzigkeit changiert.
5. Verdeckt in der Troll-Farm
(buzzfeed.com, Katarzyna Pruszkiewicz & Wojciech Cieśla)
Die polnische Reporterin Katarzyna Pruszkiewicz recherchierte im Auftrag des Recherche-Kollektivs “Investigative Europe” und des Recherche-Büros “Fundacja Reporterów” sechs Monate verdeckt in einer sogenannten Troll-Farm in Warschau. Sie verfasste dort Loblieder auf Polens Staatssender, hetzte gegen LGBTs und warb für einen linken Politiker. Eine schier unglaubliche Geschichte, die nun auch in deutscher Sprache vorliegt.
6. Empörung über “Back to black”-Ausgabe von “Elle”
(sueddeutsche.de, Theresa Hein)
Die deutschsprachige Ausgabe der “Elle” hat es zu internationaler Aufmerksamkeit geschafft — die ist jedoch reichlich negativ. Der Titel und ein Beitrag (“Back to Black”) seien missverständlich, so die Kritik. Das berühmte Supermodel Naomi Campbell schrieb auf Instagram: “I’ve said countless of times we are not a TREND. We are here to STAY. It’s ok to celebrate models of color but please do it in an ELEGANT and RESPECTFUL way.” Die Magazinmacherin Sabine Nedelchev sah sich daraufhin gezwungen, eine Art Entschuldigung zu veröffentlichen: “Es war falsch, die Coverzeile ‘Back to Black’ zu verwenden, die so missverstanden werden könnte, als seien schwarze Individuen eine Art Fashion-Trend. Das war nicht unsere Absicht und wir bedauern es, nicht sensibler mit den möglichen Interpretationsweisen umgegangen zu sein.”
7. #56 Meghan & Harry – Wie mächtig sind die Boulevard-Medien?
(deutschlandfunkkultur.de, Christine Watty & Johannes Nichelmann, Audio: 48:32 Minuten)
Ausnahmsweise heute ein siebter Medienlink: In der aktuellen Folge des “Deutschlandfunk Kultur”-Podcasts “Lakonisch Elegant” geht es um die Macht der (britischen) Boulevardmedien. Mit dabei der Berliner Medienanwalt Christian Schertz sowie BILDblog-Chef und Boulevard-Experte Moritz Tschermak.