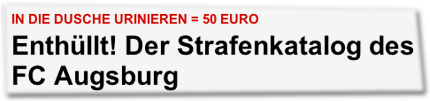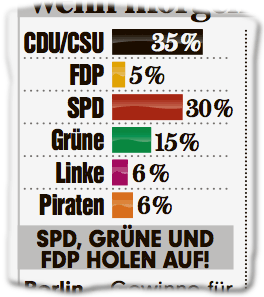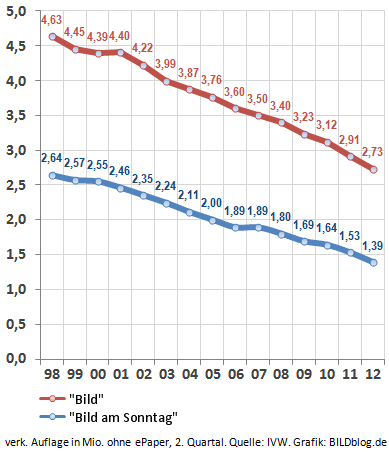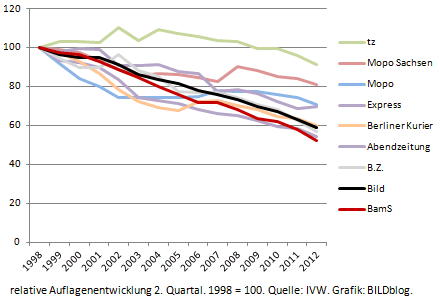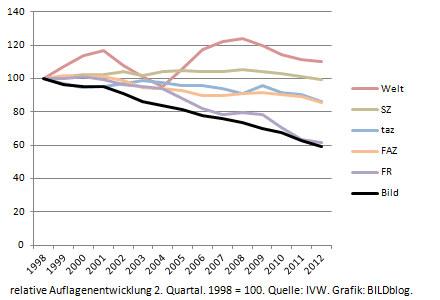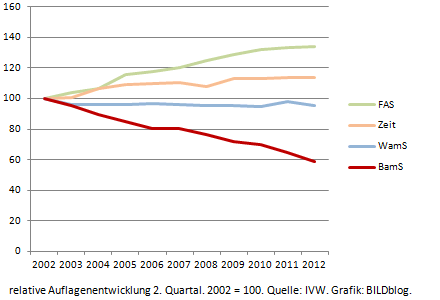Am Freitag wurden in London die 30. Olympischen Sommerspiele der Neuzeit eröffnet. Im ausverkauften Olympiastadion wohnten 80.000 Zuschauer dem bunten Spektakel und dem Einmarsch der Athleten bei — aber wie viele waren es wohl in aller Welt vor den Bildschirmen?
Bereits am Donnerstag hatte der Sportinformationsdienst (sid) zur Frage, wer die Olympische Flamme entzünden wird, geschrieben:
So kurz vor dem mit Spannung erwarteten Moment, den 80.000 Zuschauer im Stadion und rund vier Milliarden Menschen rund um den Globus vor dem Fernseher verfolgen werden, erreichen die Spekulationen um Mr. oder Mrs. X ihren Höhepunkt.
Die dpa hatte ebenfalls am Donnerstag berichtet:
Für die Zeremonie, künstlerisch gestaltet von Star-Regisseur Danny Boyle, erwartet [Organisationschef Sebastian] Coe vier Milliarden Zuschauer in aller Welt – mehr als die Hälfte der Menschheit.
Am Freitag wiederholte dpa diese Zahl:
Diesmal erwartet das IOC weltweit vier Milliarden Olympia-Fans vor den Fernsehern.
Um 22.05 Uhr, nur wenige Minuten nach Beginn der Eröffnungsfeier, tickerte der sid für die Samstagszeitungen, die zu dieser Zeit in den Druck gingen:
Mit einem spektakulären Knalleffekt hat um 21.03 Uhr Ortszeit die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London begonnen. Bis zu vier Milliarden Zuschauer auf der ganzen Welt saßen vor den Fernsehschirmen, als vier Modelle der olympischen Ringe an Ballons in den Himmel aufstiegen.
Um 22.42 Uhr, drei Stunden vor dem Ende der Eröffnungsfeier, schrieb dpa bereits:
62 000 Zuschauer im Olympiastadion und bis zu vier Milliarden Menschen weltweit vor den TV-Geräten ließen sich am Freitagabend von einer stilvollen Show verzaubern, bei der Tradition und Moderne in bunten Bildern miteinander verschmolzen.
Es war inzwischen Samstag, 1.19 Uhr, die Feier war immer noch nicht ganz vorbei, als der sid wiederum berichtete:
Große Emotionen, jede Menge Spektakel und Queen Elizabeth II als “Bond-Girl”: Mit einer bewegenden Reise durch die Geschichte Großbritanniens, einem musikalischen Zeitraffer und Showeffekten im besten Hollywood-Stil hat London die Athleten der Welt begrüßt und vier Milliarden Zuschauer in aller Welt begeistert.
In einer dpa-Meldung von Samstagnachmittag hatte sich die Zahl der Zuschauer dann schon rapide reduziert:
Eine Milliarde Menschen in aller Welt haben die begeistert gefeierte Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von London im Fernsehen gesehen. Diese Schätzung gab die Regierung am Samstag in London bekannt.
Die Zahl von vier Milliarden Menschen – “mehr als die Hälfte der Menschheit”, wie dpa richtig angemerkt hatte – hatten die Veranstalter schon im Vorfeld ausgegeben, die Nachrichtenagenturen hatten sie zunächst einfach weitergeplappert — obwohl einem die Zahl mit etwas gesundem Menschenverstand als geradezu grotesk hochgegriffen erscheinen musste.
Die Website “Sporting Intelligence” (die im vergangenen Jahr schon vorgerechnet hatte, dass die weltweiten Zuschauerzahlen der sogenannten “Royal Wedding” von Prinz William mit Kate Middleton eher bei 300 Millionen als bei den vorher postulierten zwei Milliarden lagen), hat schon am Donnerstag erklärt, warum die Zahl von vier Milliarden “bollocks” (“völliger Unfug”) ist:
Die Welt hat sieben Milliarden Bewohner, die in 1,9 Milliarden Haushalten leben, welche durchschnittlich 3,68 Mitglieder haben.
Von diesen 1,9 Milliarden Haushalten haben nur 1,4 Milliarden einen Fernseher, geschweige denn Internet. Es sind die ärmeren Haushalte, die dazu neigen, keinen Fernseher zu haben, und sie haben auch die größeren Haushalte. Also haben etwa 2,5 Milliarden Menschen keinen Zugang zum Fernsehempfang.
Zuschauerinteresse in Deutschland
Obwohl in Deutschland viele Menschen einen Fernseher haben, die Eröffnungsfeier zeitlich günstig lag, das Interesse mutmaßlich groß und das Wetter überwiegend schlecht war, schaltete hierzulande nur etwa jeder zehnte Einwohner ein: Das ZDF verzeichnete Zuschauerzahlen von 7,66 Millionen.
Wir müssen auch die Zeit in Betracht ziehen, zu der die Londoner Zeremonie stattfinden wird: zwischen 20 Uhr und Mitternacht britischer Zeit.
Asien wird schlafen, denn es wird mitten in der nacht sein. 4,1 Milliarden der Weltbevölkerung leben in Asien. Die allermeisten von ihnen werden nicht zuschauen.
Das belegbar meist gesehene Ereignis der Menschheitsgeschichte – und das bis heute einzige “echte Milliarden”-Ereignis – war die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking 2008.
Die “durchschnittliche” Zuschauerzahl (jene, die die vierstündige Veranstaltung in voller Länge gesehen haben) lag bei 593 Millionen Menschen, viele davon in der Gastgebernation China, dem bevölkerungsreichsten Land der Erde. Chinas 1,3-Milliarden-Bevölkerung war der Grund, warum die Veranstaltung so populär war. In Großbritannien, zum Beispiel, haben nur 5 Millionen Leute die gleiche Veranstaltung verfolgt.
Insgesamt haben 984 Millionen Menschen in aller Welt die Eröffnung der Spiele 2008 am heimischen Fernseher eingeschaltet und die Differenz von 16 Millionen, die zur Milliarde fehlt, wurde fast sicher durch die Leute erreicht, die rund um die Welt an öffentlichen Plätzen zugesehen haben.
Die eine Milliarde, die die Feier in Peking verfolgt haben, war einmalig hoch, weil es so eine wichtige Sache im Gastgeberland war, das eine einmalig hohe Bevölkerungszahl hat.
(Übersetzung von uns.)
Die Argumentation geht noch länger weiter, knapper hat es der “Guardian” in seinem Olympia-Medienblog aufgeschrieben:
Es ist eine große, glatte Zahl, also lieben die Medien sie, und es steht überall — aber werden wirklich vier Milliarden Menschen die Olympische Eröffnungsfeier sehen? In einem Wort: nein. In ein paar Worten mehr: natürlich nicht, wie nach nur einem Moment Nachdenken klar sein sollte.
(Übersetzung von uns.)
Aber wer würde bei einer großen, glatten Zahl schon einen Moment nachdenken?
Mit Dank an Rüdiger M.