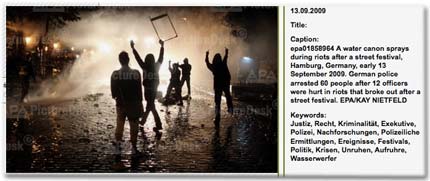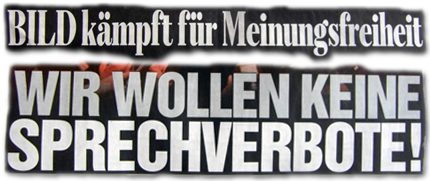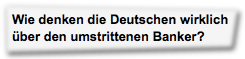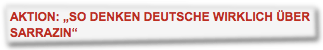6 vor 9
Um 6 Minuten vor 9 Uhr erscheinen hier montags bis freitags handverlesene Links zu lesenswerten Geschichten aus alten und neuen Medien. Tipps gerne bis 8 Uhr an [email protected].
1. “Medien-Doktor”
(medien-doktor.de)
Ein neues Projekt des Lehrstuhls Wissenschaftsjournalismus der TU Dortmund beurteilt “die Qualität medizinjournalistischer Beiträge in Publikumsmedien nach festgelegten Kriterien.”
2. “Wie häufig sind Depressionen? Und wem nützt es, wenn die Zahlen steigen?”
(io1.blogspot.com, Patrik Tschudin)
Patrik Tschudin verfolgt, wie eine Pressemitteilung des Bundesamts für Gesundheit BAG über die Nachrichtenagentur SDA in die Onlineportale von Newsnetz findet.
3. “Josef F.: Anzeige gegen Anwalt und Journalisten”
(justiz.gv.at)
Das Bundesministerium für Justiz in Österreich erhebt eine verwaltungsstrafrechtliche Anzeige gegen einen “Bild”-Reporter und seinen Anwalt. Sie besuchten Josef Fritzl ohne Genehmigung. “Laut Terminliste/Besucherliste wurde der Untergebrachte Josef F. von
einem Anwalt (ausgewiesen mit Anwaltsausweis) und einem vorgeblichen Mitarbeiter in dessen Anwaltskanzlei (ausgewiesen durch österreichischen Personalausweis) besucht.”
4. “Welche Nutzen und Risiken haben Kernkraftwerke?”
(ardmediathek.de, Video, 73 Minuten)
In der Sendung “Beckmann” kritisiert der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen, Bernhard Witthaut, die Darstellung der Lage bei den Protesten gegen die Castor-Transporte (ab 8:30 Minuten): “Also ich glaube eher, dass das Bild in der “Bild-Zeitung” die Situation sehr verfälscht. Das ist nicht die Situation, die ich persönlich erlebt habe, auch nicht die Situation, die mir viele Demonstranten, aber auch viele Kolleginnen und Kollegen geschildert haben. Deswegen finde es auch ein bisschen verantwortungslos, was die ‘Bild’ da gemacht hat.”
5. “Analogkäse schmeckt besser!”
(dradio.de, Jörg Wagner, Audio, 45 Minuten)
Ein Feature über Public Relation als fünfte Gewalt. Es geht um Analogkäse, Surimi oder um die Kandidatur von Joachim Gauck für das Amt des Bundespräsidenten und die Rolle von “Spiegel” und “Bild” dabei (mp3-Datei, 20 MB).
6. “India on $200 Million a Day? Not!”
(thecaucus.blogs.nytimes.com, Michael D. Shear, englisch)
Kostet die Indien-Reise des US-Präsidenten 200 Millionen US-Dollar pro Tag? Nein. “That’s not to say that presidential trips are not costly. A General Accounting Office report calculated that President Clinton’s similar 12-day trip to Africa in 1998 cost $42.8 million, or about $3.6 million a day.” Siehe dazu auch “The Daily Show” (Video, 5:23 Minuten).