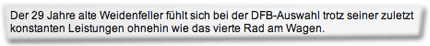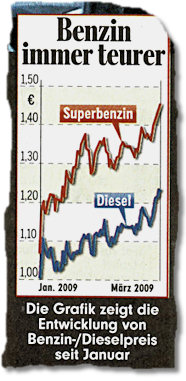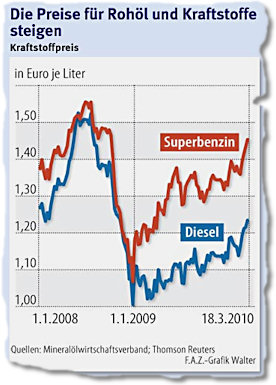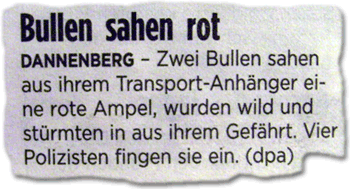6 vor 9
Um 6 Minuten vor 9 Uhr erscheinen hier montags bis freitags handverlesene Links zu lesenswerten Geschichten aus alten und neuen Medien. Tipps gerne bis 8 Uhr an [email protected].
1. “Dauerschleife aus Berlin”
(faz.net, Marcus Jauer)
Marcus Jauer über den unlösbaren Widerspruch zwischen Politikern und Journalisten in Berlin, “voneinander unabhängig und aufeinander angewiesen” zu sein – “weshalb sich beide Seiten offenbar darauf geeinigt haben, dass keiner fragt, ob etwas berichtet wird, weil es geschieht, oder nur etwas geschieht, weil es berichtet wird”.
2. “Kommt das EU-Einheitsbrot?”
(narragonien.de)
Nein, das EU-Einheitsbrot kommt nicht. “Was BILD und MAZ nämlich nicht wissen oder vielmehr nicht wissen wollen, ist, dass die EU dem kleinen Bäcker um die Ecke überhaupt nichts vorschreiben will, sondern dass es eigentlich nur um große industrielle Backbetriebe geht.”
3. “7 Überlebenstipps für Verlage”
(bastian.nutzinger.net)
Bastian Nutzinger gibt der Print-Branche ein paar Überlebenstipps. “Versteht euch doch einfach als Teil dieser Gemeinde und interagiert entsprechend mit Ihr. Nicht jeder Blogartikel da draußen ist Journalistengold, aber einige sind hochinteressant. Warum nicht darauf verweisen?”
4. “Reden wie Markus Schächter (4)”
(medienpiraten.tv, Peer Schader)
Bauwerke aus Wörtern von ZDF-Intendant Markus Schächter einfach entschlüsselt.
5. Google und die Autorenrechte
(carta.info, Robin Meyer-Lucht)
Robin Meyer-Lucht stört sich an der Aussage von Thomas Schmid, dass Google mit den Autorenrechten kaum weniger ignorant als China mit dem Informationsrecht umgehe. “Das Internet und Google haben unsere Nachrichtenwelt endlich de-oligopolisiert, Google hält sich an das bestehende Urheberrecht und Google befördert – etwa auch über YouTube – die Meinungsfreiheit ganz maßgeblich.”
6. Interview mit Wolfgang Kubicki
(zeit.de, Stephan Lebert und Stefan Willeke)
In einem langen, lesenswerten Interview sagt Wolfgang Kubicki, wie sich eine Falschmeldung auf ihn auswirkte: “Ich dachte: Das muss jetzt sofort aufhören, und das hört nur auf – für deine Familie, für deine Mutter –, wenn du nicht mehr da bist. Ich habe in jener Nacht, vielleicht zehn Minuten lang, sehr intensiv überlegt, ob ich mir das Leben nehmen soll.”