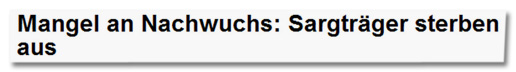Die meisten Menschen fürchten sich vor dem Tod, nur die wenigsten sehen seine Vorteile: Nie wieder an kalten November-Morgen vom Wecker aus dem Bett gescheucht werden. Nie wieder durchnässt im Regen warten. Nie wieder Post vom Finanzamt. Und kein Chef mehr, dem am frühen Freitagabend einfällt, dass er für seinen Vortrag am Montag noch dringend eine Präsentation braucht, um die er sich aber wegen des nahenden Wochenendes unmöglich selbst kümmern kann.
Der Tod könnte so schön sein, wenn er nicht leider auch einige Nachteile hätte. Zum Beispiel: die Langeweile.
Ja, was tun? Die Frage wäre überhaupt neu, denn natürlich gäbe es auch keine Wochenenden mehr, die am Freitagnachmittag mit Stress beginnen und fünf Minuten später, am Sonntagabend um Mitternacht völlig überraschend enden, weil die Zeit zwischen den Powerpoint-Folien für den Chef einfach zerrieselt ist — und der Vortrag an sich natürlich auch noch gemacht werden musste.
 Ralf Heimann hat vor ein paar Jahren aus Versehen einen Zeitungsbericht über einen umgefallenen Blumenkübel berühmt gemacht. Seitdem lassen ihn abseitige Meldungen nicht mehr los. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt zusammen mit Daniel Wichmann “Hier ist alles Banane — Erich Honeckers geheime Tagebücher 1994 – 2015”. Fürs BILDblog kümmert er sich um all die unwichtigen Dinge, die in Deutschland und auf der Welt so passieren.
Ralf Heimann hat vor ein paar Jahren aus Versehen einen Zeitungsbericht über einen umgefallenen Blumenkübel berühmt gemacht. Seitdem lassen ihn abseitige Meldungen nicht mehr los. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt zusammen mit Daniel Wichmann “Hier ist alles Banane — Erich Honeckers geheime Tagebücher 1994 – 2015”. Fürs BILDblog kümmert er sich um all die unwichtigen Dinge, die in Deutschland und auf der Welt so passieren.(Foto: Jean-Marie Tronquet)
Nur noch Faulheit, Trägheit, Müßiggang. Nur noch Zeit, die wie ein endloses Bächlein vorbeiplätschert.
Vielleicht muss man sich den Tod einfach so vorstellen: Man liegt irgendwo herum und wartet schlaflos auf einen Morgen, der niemals kommen wird. Ein fürchterlicher Zustand, der nur durch den Gedanken erträglich wird, dass man immerhin vom Finanzamt nichts mehr zu befürchten hat. Aber dann wälzt man sich auf die andere Seite, schaut noch mal hin, und da liegt plötzlich dieser Brief, auf dem man in Umrissen das Landeswappen erkennt.
In Sarzeau im Westen Frankreichs muss man mit so etwas inzwischen rechnen. Das Finanzamt dort hat vor ein paar Tagen eine Steuerforderung an eine Tote zugestellt. Der Bote kam vermutlich dreimal, fand aber weder Klingel noch Briefkasten, und auch die Nachbarn zeigten sich wenig kooperativ, was die Adresse hätte erklären können. Die lautete: “Friedhofsweg, Reihe E, Grab 24”.
Die Anschrift ist entweder übersehen worden, oder in den Finanzbehörden ist längst eine neue Zeit angebrochen, in der nicht nur die Unterschiede zwischen Männern und Frauen eingeebnet werden, sondern auch die zwischen Lebenden und Toten.
Nachdem schon die Erbschaftssteuer geflossen ist, kämen dann trotzdem weiter die Vorauszahlungsbescheide, und die Einkommensteuer würden wir auch in der Ewigkeit einfach weiterzahlen. Ständig riefe der Steuerberater an, weil noch irgendwelche Belege fehlten. Dabei wollten wir einfach nur untätig in der Hölle schmoren, wie wir es verdient haben.
Das ganze System ist marode. Es fängt schon bei den Bestattern an, die ihre Kunden skrupellos über den Tisch ziehen, statt sie dort einfach, wie es ihre Aufgabe wäre, zu waschen und nett anzukleiden.
In Gießen gab es gerade wieder so einen Fall. Ein Ehepaar hat das Geld für die eigene Feuerbestattung per Vorkasse überwiesen. Dann starb die Frau, und der sonst nicht an Kundenbewertungen gewöhnte Bestatter hatte offenbar vergessen, dass ein Vertragspartner — was in der Regel nicht vorkommt — nach getaner Arbeit noch lebt. Die eigentlich schon bezahlten Rechnungen gingen an ihn. Der Mann hat den Bestatter nun angezeigt.
Da kann einem die Lust aufs Sterben schon vergehen. Und anscheinend ist man mit diesem Gefühl nicht allein:
Quelle: “Mindener Tageblatt”
Wenn die Bestatter nicht aufpassen, wird es ihnen irgendwann genauso ergehen wie den Kutschen-Bauern und den Zeitungsverlagen. Die Kunden werden sich was Neues suchen, vielleicht irgendwas im Internet.
Es gibt ja schon heute kaum noch Menschen, die mit ihrer eigenen Bestattung so zufrieden waren, dass sie sagen würden: Empfehle ich uneingeschränkt weiter. Was aber auch kein Wunder ist. Wer will schon mit einer Branche zu tun haben, die ihre Kunden erst abzockt und dann in einem Loch verscharrt? Anscheinend sind nicht mal die Beschäftigten selbst bereit, das länger mitzutragen:
Der letzte Bestatter wird vermutlich auch am Wochenende nach seinem Tod noch arbeiten müssen, um sich selbst unter die Erde zu bringen. Und solche Arbeitsbedingungen sind wirklich niemandem zuzumuten.
Dabei ist das Sargtragen an sich eine attraktive Tätigkeit mit vielen Aufstiegschancen. Und natürlich spielt die Digitalisierung auch hier eine große Rolle. Die Terminabstimmung erfolgt heute oftmals per Smartphone. Viele Jugendliche wissen das gar nicht.
Und das wiederum ist symptomatisch für diese Branche. Es ist nicht alles so schlecht, wie es auf den ersten Blick erscheint. Das gesamte Bestattungswesen bräuchte vor der Reform vermutlich erst mal eine Image-Kampagne. Der Tod muss endlich wieder attraktiv werden. Nicht nur für die Dienstleister, auch für die Kunden. Aber wie verklickert man das den Leuten?
Man müsste da mal eine Werbeagentur beauftragen, die einen Claim entwirft, der alles auf den Punkt bringt. Dieses Gefühl, dass sich etwas zum Besseren verändert. Die Aufbruchstimmung. Den frischen Wind. Wobei, vielleicht braucht man doch gar keine Werbeagentur. Vielleicht nimmt man einfach diese Überschrift: