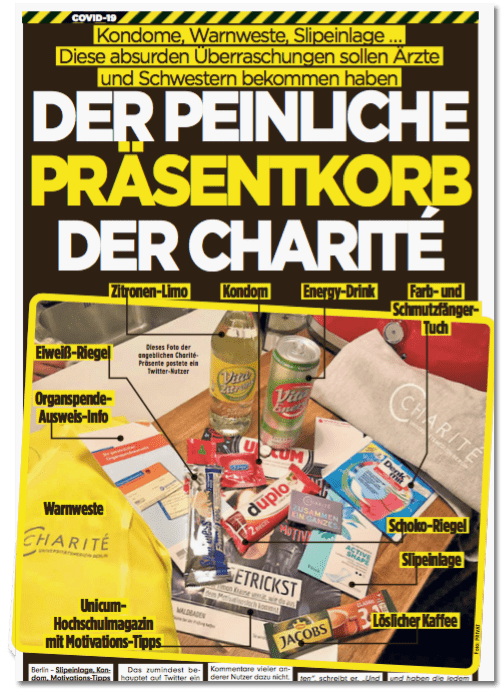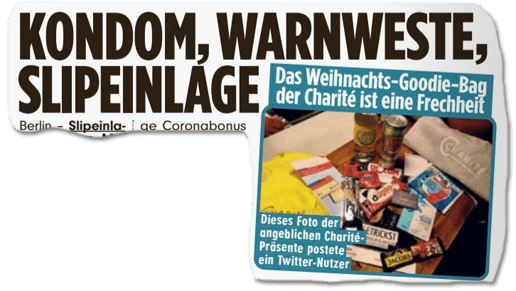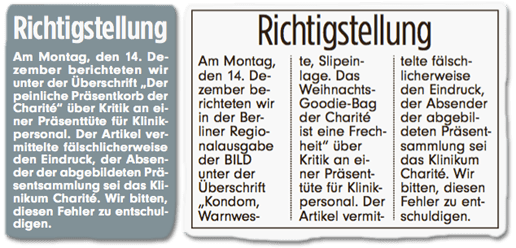1. Spahn will Presse-Auskünfte aus Berliner Grundbüchern einschränken lassen
(tagesspiegel.de, Jost Müller-Neuhof)
Jens Spahn hat anscheinend ein spezielles Verhältnis zu Transparenz und Pressefreiheit – jedenfalls, wenn es die eigenen Belange betrifft: “Nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen Grundbuchämter in Berlin recherchierenden Journalistinnen und Journalisten künftig nicht mehr ohne weiteres Auskünfte zu seinen privaten Immobiliengeschäften erteilen dürfen. Das geht aus einer Beschwerde von Anwälten des Ministers an die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt.”
2. “Triumphgeheul verbietet sich”
(fr.de, Bascha Mika)
Bascha Mika hat sich mit dem Medienethiker Tanjev Schultz über “Bild” und den “Bild”-Chef Julian Reichelt unterhalten, gegen den derzeit ein Compliance-Verfahren läuft: “Ich sehe einen öffentlichen Impuls, jetzt mit Häme und Vorverurteilungen an die Sache heranzugehen. Ich selbst habe ja auch kritische Worte gewählt. Aber man muss sich vor Selbstradikalisierung schützen, vor Schadenfreude und Häme. Man braucht die aktuellen Vorgänge nicht, um die Bild-Zeitung als problematisch einzustufen. Triumphgeheul verbietet sich.”
3. Viele Fakten, wenig Kritik
(deutschlandfunk.de, Mirjam Kid, Audio: 6:33 Minuten)
Martin Fritz arbeitet seit 20 Jahren als Korrespondent in Japan und kennt daher die Schwächen der japanischen Medienlandschaft recht gut: “Die meisten Journalisten verstehen Journalismus als Beruf und weniger als Berufung. Sie legen eher eine Angestelltenmentalität an den Tag und halten ihre politische Meinung zurück. Die fassen dann die Fakten zusammen – fertig ist der Artikel.” Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk findet Fritz aber auch lobende Worte für eine andere Sorte von Journalistinnen und Journalisten.
Weiterer Lesehinweis: Das bereits gestern empfohlene Interview mit ARD-Korrespondent Peter Kujath: 10 Jahre Atomkatastrophe Fukushima: ARD-Reporter blickt zurück (br.de, Konstantin König).
4. Ist Gendern der “Tod der Sprache”? (Spoiler: Nein)
(arminwolf.at)
Der ORF-Journalist und Moderator Armin Wolf bemüht sich um eine geschlechtergerechte Sprache und erntet dafür teilweise empörte Reaktionen: “Ich bin ja immer wieder erstaunt, welche Emotionen dieses Thema auslöst. Auch bei Menschen, die sehr aufgeregt fragen: ‘Haben wir denn keine anderen Probleme ???’ und anscheinend keine anderen Probleme haben als eine gesprochene Mini-Pause in Politiker innen. Möglicherweise sind sie auch davon überzeugt, dass alle anderen Probleme verschwänden, würde ich nur wieder die Politiker sagen.”
5. Darum gibt es jetzt Netzsperren gegen Streamingportale
(spiegel.de, Torsten Kleinz)
Neben den legalen, aber kostenpflichtigen Streamingportalen existieren im Netz kostenlose, aber illegale Streamingportale, die sich oft über Pornowerbung oder allerlei obskure Angebote und Klick-Fallen finanzieren. Die Clearingstelle Urheberrecht im Internet will diesen Seiten ein Ende bereiten und setzt dabei auf das Instrument der Netzsperre. Torsten Kleinz erklärt die diffizile Situation und zeigt, warum das Vorgehen der Clearingstelle nicht überall auf Zustimmung trifft.
Weiterer Lesehinweis: Bei netzpolitik.org kommentiert Markus Beckedahl: “Die Musikindustrie verkündet die Rückkehr der Netzsperren. Das Instrument hat gefährliche Nebenwirkungen und wird in autoritären Staaten zum Aufbau einer Zensurinfrastruktur missbraucht. Seht es endlich ein: Netzsperren schaffen mehr Probleme, als sie lösen.”
6. Der Bundesabkanzler Dieter Bohlen macht Schluss bei “DSDS” – es war höchste Zeit
(rnd.de, Imre Grimm)
Dieter Bohlen steigt als Chefjuror bei “Deutschland sucht den Superstar” aus. Für Imre Grimm ein guter Anlass, auf die TV-Karriere des “Poptitanen” zurückzublicken: “Ausgerechnet Bohlen, der eiskalte Ausbeuter von Teenie-Träumen, gerierte sich knapp zwei Jahrzehnte lang als Anwalt der Chancenlosen. Das war natürlich immer grober Unfug. Sein sozialdarwinistisches Kulturverständnis, wonach der plötzliche Durchbruch auf der Bühne als Blitzausweg aus Plattenbau, Berufsschulelend und Prekariat bedeutet, war nur eine nützliche Lüge.”