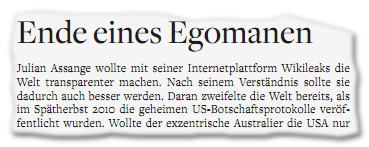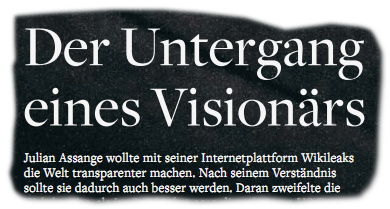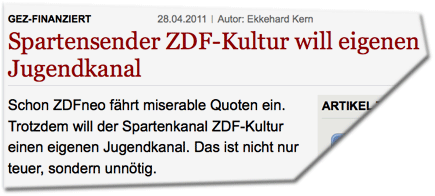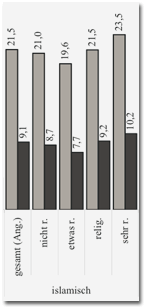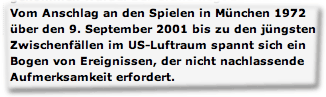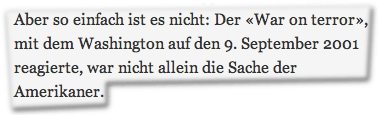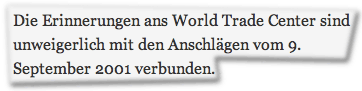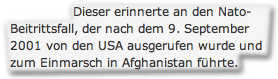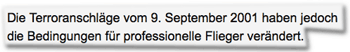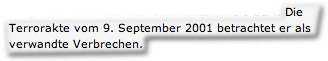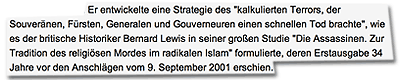In London hat ein Kosmetikgeschäft geschlossen. Dies allein ist keine Meldung, die es in “Die Welt” schaffen würde — schon gar nicht in die dortige Rubrik “Meinung”.
Wenn es sich allerdings um ein israelisches Kosmetikgeschäft handelt und der Schließung Proteste, Verzeihung: eine wöchentliche “wilde Demo Hunderter junger Muslime”, vorangegangen sind, dann ist das natürlich ein Fall für “Die Welt” — und für die üblichen Islamfeinde, die solche Meldungen weitertratschen.
Autor Michael Stürmer, Historiker und Chefkorrespondent der “Welt”-Gruppe, hatte sich allerdings auch alle Mühe gegeben, das Ende des Londoner Flagship Stores der israelischen Kosmetikfirma Ahava an das schwarz-weiße Weltbild der Islamophoben anzupassen. Auf der einen Seite der christlich-jüdische, tolerante Westen, auf der anderen Seite eben die “wilden” Muslime, die in London am Liebsten “Londonistan” ausrufen würden:
Zur Gentrifizierung gehörte die Einrichtung der Londoner Hauptfiliale des israelischen, am Toten Meer beheimateten Unternehmens “Ahava” – was auf Hebräisch Liebe heißt.
Zu Londonistan gehört die jeden Samstag stattfindende wilde Demo Hunderter junger Muslime, die dieser Tage der Liebe ein Ende machten und das Unternehmen zwangen, den Laden aufzugeben.
Ausführlich beschreibt Stürmer die tollen Produkte von Ahava, die aus dem Heilschlamm vom Grunde des Toten Meeres hergestellt werden, und von der ruhmreichen Geschichte dieser Produkte (“Es gibt nicht viele moderne Kosmetikprodukte, deren Lob schon im Alten Testament zu finden ist.”).
Aber nicht alle Menschen finden die Ahava-Produkte so toll wie Michael Stürmer, weswegen es zu unschönen Szenen kam:
In London hat der Heilschlamm zwar Kunden angezogen, aber leider auch gewalttätige Protestierer, die den benachbarten Läden, von Ahava nicht zu reden, das Leben so zur Hölle machten, als sei noch einmal Sodom und Gomorrha. Die Polizei gab sich redlich Mühe, aber nicht genug.
Nach Wochen des Kräftemessens gaben die braven Bobbys auf. Weder Polizei noch Anwohner hatten den Nerv, den Randalierern standzuhalten.
Für Stürmer ist klar, womit wir es hier zu tun haben:
London, einst die zivilisierteste Stadt in Europa, räumt zugereisten Fanatikern ein Vetorecht darüber ein, ob jemand einen Laden führen darf.
Die Lehre für London und den Rest der Welt: Wenn wir so weitermachen, ist Londonistan bald überall.
Wenn er sich nicht seinen ausführlichen Ausflügen in die Geschichte von Heilschlamm, Altem Testament und Totem Meer gewidmet hätte, hätte Stürmer vielleicht noch Zeit gehabt, auf ein nicht ganz unbedeutendes Detail in der Geschichte der Firma Ahava einzugehen: Die Firma produziert in einer israelischen Siedlung im Westjordanland, das eigentlich zu den palästinensischen Autonomiegebieten gehört. Diese Siedlung ist nach internationaler Einschätzung illegal und verstößt gegen die Genfer Konvention.
Verschiedene Organisationen wie die pazifistische Bürgerrechtsbewegung Code Pink haben Ahava vorgeworfen, mit Bodenschätzen Geschäfte zu machen, die den Palästinensern gestohlen worden seien. In Südafrika dürfen Waren wie die von Ahava nicht mehr als israelische Produkte verkauft werden, sondern müssen als “Produkte illegaler Besiedlung in den Besetzten Palästinensischen Gebieten” ausgezeichnet werden.
Diese Informationen wären hilfreich gewesen um zu verstehen, dass sich die Proteste gegen Ahava nicht auf plumpen Antisemitismus reduzieren lassen. Vielmehr wären sie ein schönes Beispiel um zu zeigen, wie sich der seit Jahrzehnten schwelende Nahost-Konflikt im Alltag und im Badezimmerschrank westlicher Bürger niederschlägt. Doch Michael Stürmer hat sich dagegen entschieden, diese Geschichte zu erzählen.
Mit Dank an Christoph G.