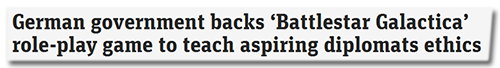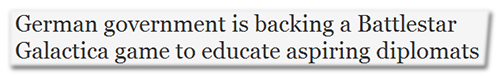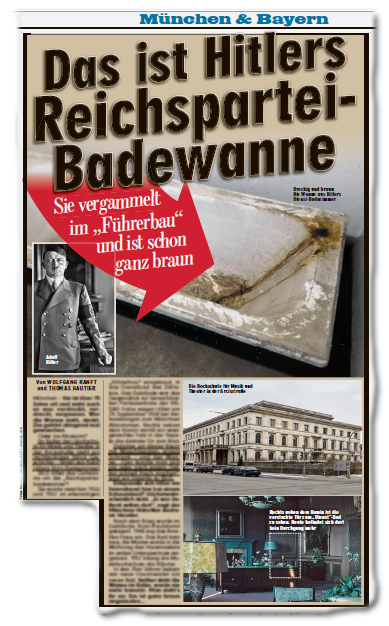1. “Journalisten als Staffage”
(weblogs.evangelisch.de, Frank Lübberding)
Wie sind die Leistungen von Tilo Jung in der Bundespressekonferenz zu beurteilen? Frank Lübberding schreibt: “Er war wirklich penetrant, vor allem wenn es um den Umgang der Bundesregierung mit den Thema ‘Folter in den USA’ ging. Im Berliner Alltag spielte das bald kein Rolle mehr. Dort geht es dann wieder um die Performance der Minister, wie sie im Berliner Hauptstadtdorf namens Mitte reüssieren. So sorgte Jung für die Irritation einer altehrwürdigen Institution, die keinen anderen Sinn mehr hat als den, nun einmal da zu sein.”
2. “In eigener Sache – Datenklau”
(taz.de)
“Die taz wurde wohl von einem Angestellten ausspioniert”, schreibt die “taz” in eigener Sache, liefert dazu eine Chronologie, leitet arbeitsrechtliche Schritte ein und stellt Strafanzeige. In einem Kommentar dazu schreibt Ines Pohl: “Tatsächlich haben wir es mit einer Spionageaffäre zu tun. Der Schock bei uns allen sitzt tief.”
3. “‘Befugtes Spionieren'”
(heise.de/tp, Markus Kompa)
Der Spionage verdächtigt wird zufolge mehrerer Quellen Sebastian Heiser, der kürzlich in seinem Blog aufgedeckt hatte, wie 2007 die Sonderseiten der “Süddeutschen Zeitung” entstanden. “Auch, wenn Heiser nun im Zwielicht steht, gilt für ihn die Unschuldsvermutung. In der Taz waren durchaus schon professionelle Spitzel unterwegs – darunter V-Leute aus dem Ministerium für Staatssicherheit und dem Verfassungsschutz. Und da Heiser auch brisante Themen behandelt und sich etliche Feinde gemacht hat, kann nicht per se ausgeschlossen werden, dass jemand ein illegales Auge auf die Redaktionsräume wirft oder ein Ei legt. So manche Abhöraffäre hatte in Wirklichkeit einen harmlosen Hintergrund.”
4. “Verschwörung, und: The War of the Worlds”
(lesenmitlinks.de, Jan Drees)
Gab es nach der Radio-Ausstrahlung von “Der Krieg der Welten” am 30. Oktober 1938 eine Massenpanik? “Besagte Panik hat es nie gegeben. Selbst jene die später eingeschaltet haben sind mitnichten auf die Straße geflohen. Es gab keine Selbstmordversuche, keine traumatisierten Hörer, die später mit Elektroschocks behandelt werden musste. Dennoch wird diesem genialen Hoax weiterhin geglaubt.”
5. “Die heikle Nähe von Leitmedien zur Elite”
(nzz.ch, Stephan Russ-Mohl)
Stephan Russ-Mohl liefert Hintergründe zu einer Auseinandersetzung zwischen den Medienwissenschaftlern Christoph Neuberger und Uwe Krüger (Kritik / Replik): “Einig sind sich Krüger und Neuberger im Blick auf ein Problem, das Journalisten selbst nur allzu gerne ignorieren: dass sie in Beziehungsnetzwerken leben und auch leben müssen, wenn sie mit Erfolgsaussichten recherchieren wollen. Und dass über solche Netzwerke Transparenz herzustellen wäre, wenn die Redaktionen sich nicht dem Verdacht der Mauschelei und der Hofberichterstattung aussetzen wollen. Das allerdings gälte dann auch für Medienforscher.”
6. “Über Fotografie, Kommunikation, dämliches Grinsen und den öffentlichen Raum”
(sixtus.net)
Mario Sixtus schreibt über das Fotografieren im öffentlichen Raum: “‘Frag doch vorher’ oder ‘frag doch hinterher’, lauten die beiden Standardratschläge, die einem unsichtbaren Fotografiedebattennaturgesetz folgend, immer wieder von irgendjemandem in den Raum geworfen werden. Sie sind beide nicht realisierbar.”