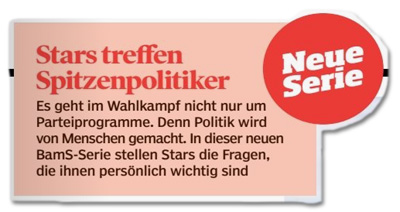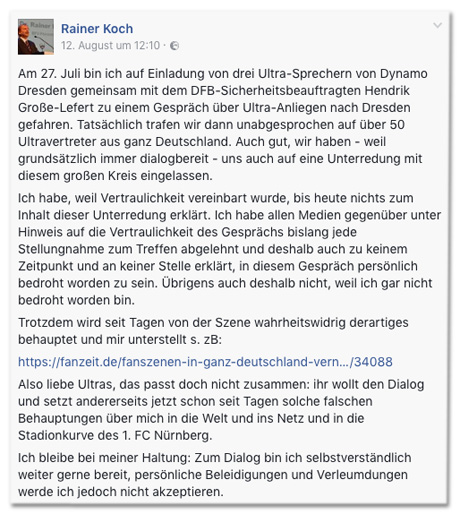1. “Waren ja Ihre Fragen, ne?”
(tagesschau.de, Julian Heißler)
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gleich vier Youtubern auf einmal ein Interview gegeben. Der Neuigkeitswert des Gesprächs habe sich in Grenzen gehalten, doch darum sei es auch nicht gegangen. Von Merkels Seite hätte man schlicht auf die drei Millionen Abonnenten gezielt, ein überwiegend junges Publikum, das man sonst nicht so ohne weiteres erreicht hätte.
Die “FAZ” bescheinigt dem Gesprächstermin insgesamt gute Noten: “Die Resonanz war bescheiden, die Interviews der vier Youtuber mit der Bundeskanzlerin aber waren vielleicht sogar besser als Vergleichbares im Fernsehen.” Jörg Schieb sieht im WDR-Blog wenig Profiteure außerhalb von Veranstalter und Beteiligten: “Im Grunde alles nur eine große Inszenierung – ohne jeden echten Erkenntnisgewinn.” Die “Süddeutsche” hat zwei der vier Youtuber interviewt und sie unter anderem nach ihrer Vorbereitung gefragt.
Der Journalist Stefan Fries kritisiert auf seinem Blog eine Umfrage, die auch im Merkel-Interview eine Rolle spielte. Auf Twitter wurde lapidar gefragt: “Habt Ihr Angst vor einem Krieg?”, was etwa die Hälfte der Befragten bejahte. Die Umfrage sei jedoch nicht repräsentativ und die Antworten verzerrt. Außerdem sei die Frage viel zu unspezifisch und die Fehlertoleranz werde ignoriert. Fries findet die Umfrage geradezu unverantwortlich und schließt mit den Worten: “100 Prozent der Autoren dieses Blogs kriegen bei solchen Umfragen zuviel.”
2. Streit um freie Bilder: Fotodienste Unsplash und Pixabay stören sich an Copycats
(irights.info, Henry Steinhau & David Pachali)
Wer keinen Etat für Bildrechte hat, freut sich über Datenbanken wie “Pixabay” und “Unsplash”. Dort liegen Bilder, die für die Verwendung im privaten und kommerziellen Umfeld freigegeben wurden und kostenlos verwendet werden dürfen. Kürzlich gab es bei den Plattformen ein Hin und Her um die Formulierung der Lizenztexte. Hintergrund: Beide Seiten stören sich an Dritt-Anbietern, die ihre Kataloge nutzen und damit eigene, funktional und gestalterisch oft ähnliche Dienste aufbauen. “Pixabay” sei jedoch mittlerweile zur bisherigen CC0-Freigabe zurückgekehrt, die man lediglich um Nutzungsbedingungen erweitert habe. “Unsplash” habe eine neue Lizenzform eingeführt, die vom “Creative Commons”-Chef kritisiert wird.
3. Wie SPIEGEL ONLINE arbeitet
(spiegel.de, Barbara Hans)
“Spiegel Online”-Chefredakteurin Barbara Hans stellt die neue Rubrik “Backstage” vor: “Dort erklären wir, welchen Weg ein Artikel nimmt, bevor er veröffentlicht wird. Wie wir digitalen Journalismus verstehen. Warum sich häufig die Meldungen verschiedener Nachrichtenseiten gleichen und welche Rolle Nachrichtenagenturen spielen. Wir sprechen über peinliche Fehler und wie die Kollegen der Dokumentation uns täglich dabei helfen, sie zu vermeiden. Auch können Sie dort lesen, wie wir uns und unsere Arbeit – das heißt mehr als 120 veröffentlichte Artikel am Tag – finanzieren: über Werbung.”
4. Seele verkauft
(kontextwochenzeitung.de, Anna Hunger)
Dem “Stuttgarter Wochenende” lag als Beilage auch der rechte “Deutschland-Kurier” bei. Für Anna Hunger stellt sich die Frage, wo die Grenze liegt zwischen verlegerischer Verantwortung und Fahrlässigkeit. Die Reaktionen der Medienbranche sind eher ablehnend, wobei meist die Legalität der Aktion betont wird. Das eigentlich Tragische an der Sache läge laut Hunger jedoch an anderer Stelle: Durch die Verteilung der rechten Postille torpediere das Stuttgarter Medienhaus die Bemühungen der Zivilgesellschaft, gegen Rassismus und Nationalismus Stellung zu beziehen.
5. Getarnte Werbung
(edito.ch, Nina Fargahi)
Im Schweizer Medienmagazin “Edito” diskutiert Nina Fargahi das sogenannte “Native Advertisement”, eine Werbeform, die sich als redaktioneller Inhalt tarnt. Das Dilemma sei kaum aufzulösen: “Werbeinhalte sollen absichtlich in einer journalistischen Aufmachung zur Verfügung gestellt werden, weil die seriöse Erscheinung die Glaubwürdigkeit und damit auch die Aufmerksamkeit bei den Mediennutzern steigert. Doch je deutlicher deklariert wird, dass es sich bei einem bestimmten Inhalt um Werbung handelt, desto leichter ist er als solche erkennbar und somit für den Mediennutzer wohl weniger relevant. Zu viel Transparenz unterläuft den Zweck einer Werbeform. Umgekehrt fühlen sich die Mediennutzer veräppelt, wenn sie dahinterkommen, dass sie gerade etwas gelesen haben, das Werbung ist, aber nicht deutlich genug als solche ausgewiesen ist.”
6. DAS ist die ungewöhnliche Methode, mit nur 3 Schritten mehr KLICKS zu bekommen
(volkerkoenig.de)
Was braucht man für erfolgreiches Klickbaiting? Blogger Volker König lüftet das streng gehütete Geheimnis, das sonst nur Industriemagnaten, Wirtschaftsbosse und Illuminaten kennen. (oder so ähnlich…)