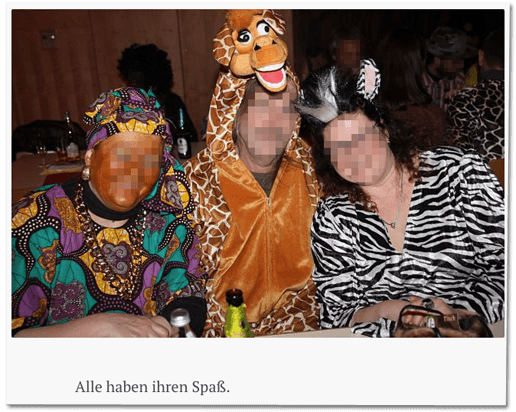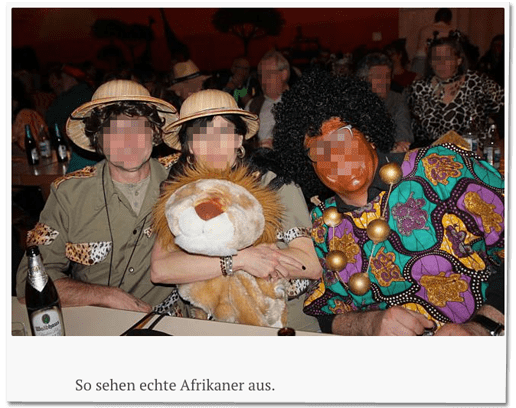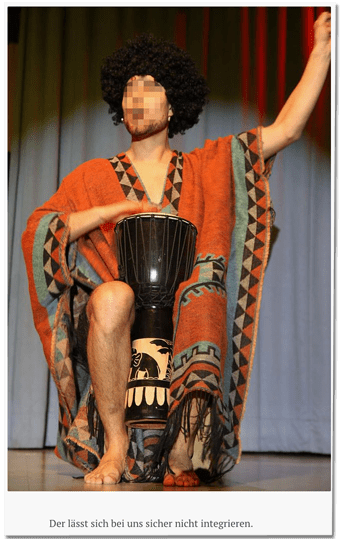1. Wie war ich?
(republik.ch, Daniel Ryser)
Daniel Ryser hat ein überaus lesenswertes Porträt des “NZZ”-Chefredakteurs Eric Gujer verfasst. Er hat ihn im Schweizer Stammhaus besucht und ist nicht davor zurückgeschreckt, Gujer auch mit unangenehmen Fragen zur wirtschaftlichen Entwicklung zu konfrontieren: “Gujer lächelt das mit einem Kopfschütteln weg, und natürlich kann man durchaus sagen, dass es völlig unwesentlich ist, dass in meinen komplett vernachlässigbaren, in Bubbles erstickenden linken Zeckenkreisen niemand mehr die NZZ liest, weil man es zum Beispiel in einer Welt der Trumps, Erdoğans, Putins, Orbáns, Bolsonaros und Johnsons irgendwann als intellektuelle Beleidigung empfand, wöchentlich erzählt zu bekommen, dass wir offenbar — zumindest in der Wahrnehmung an der Falkenstrasse — kurz vor einer totalitären Diktatur eines queerfeministischen Regenbogens stehen. Aber 30’000 verloren gegangene Print-Jahresabos lassen sich womöglich doch nicht so einfach mit Bubble und ‘lesen einfach keine Zeitung mehr’ schönreden.”
2. Was wird aus der deutschen Redaktion?
(deutschlandfunk.de, Daniel Bouhs, Audio: 4:51 Minuten)
Vergangenes Jahr wurde “Buzzfeed News”-Chef Daniel Drepper noch als “Chefredakteur des Jahres” ausgezeichnet. Heute bangen er und seine Redaktion um die berufliche Existenz. Die “Buzzfeed”-Zentrale will seinen mit Lob und Preisen ausgezeichneten deutschen Ableger abstoßen. Man möchte meinen, dass sich deutsche Medienhäuser um das tüchtige Team reißen, doch die derzeitigen Aussichten seien ungewiss.
3. Rechtsextreme podcasten ungestört bei Spotify
(rnd.de, Matthias Schwarzer)
Rechtsextreme haben das Medium Podcast für sich entdeckt — um in der Corona-Krise die Deutungshoheit zu erlangen und um ihre Ideen unters Volk zu bringen. Matthias Schwarzer hat sich angeschaut beziehungsweise angehört, wie die Gruppierung “Ein Prozent” bei ihren Audio-Produktionen vorgeht und welche Köpfe hinter dem Netzwerk stecken.
4. Lotterie: Gewinner dürfen Fragen stellen
(verdi.de, Reiner Wandler)
Pressekonferenzen der spanischen Regierung finden derzeit online und vor leeren Stuhlreihen statt. Journalistinnen und Journalisten, die eine Frage stellen wollen, müssen auf eine Art Gewinnspiel hoffen: Nur wer ausgelost werde, könne per Videoschalte auf der Pressekonferenz zu Wort kommen. Dagegen richte sich nun der Widerstand zahlreicher Medienschaffender: Mittlerweile hätten über 400 von ihnen ein Manifest mit dem Titel “Die Freiheit zu fragen” unterzeichnet.
5. Podcasts zwischen Corona-Hype und Spotify-Monopol
(medienwoche.ch, Nick Lüthi)
Corona-Podcasts haben viel für die Akzeptanz des Mediums Podcast getan. Gleichzeitig versuche Spotify, eine marktbeherrschende Stellung zu erreichen, so Nick Lüthi in der Schweizer “Medienwoche”: “Befürchtungen gehen dahin, dass sich Spotify zu einem Gatekeeper entwickelt, vergleichbar mit der Rolle von Google oder Facebook im Netz. Noch ist es nicht so weit, aber Spotify geht den Weg in diese Richtung ziemlich zielstrebig. Dabei profitiert das Unternehmen auch von jenen Produzenten, die ihre Podcasts dort zum Abruf einstellen. Und das sind so ziemlich alle.”
6. “Misstrauen Sie dieser Video-Kolumne!”
(uebermedien.de, Boris Rosenkranz, Video: 1:19 Minuten)
“Focus”-Kolumnist Jan Fleischhauer kommentiert die Video-Kolumne von Jan Fleischhauer. Boris Rosenkranz hat eine Video-Collage mit Fleischhauer-Sprech-Schnipseln arrangiert und lässt ihn unter anderem sagen: “Misstrauen Sie dieser Video-Kolumne! Bis irgendwann die Polizei kommt.”