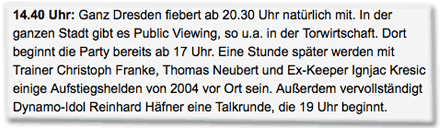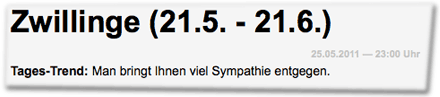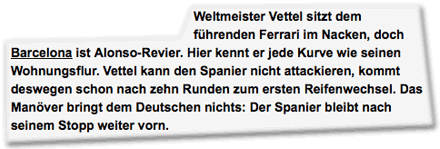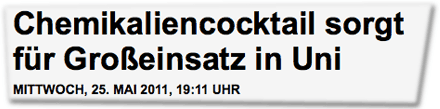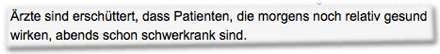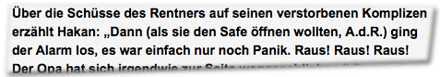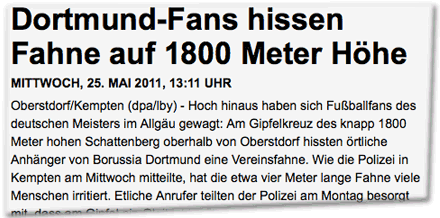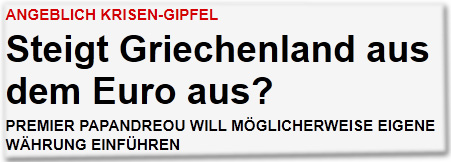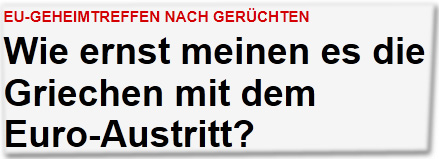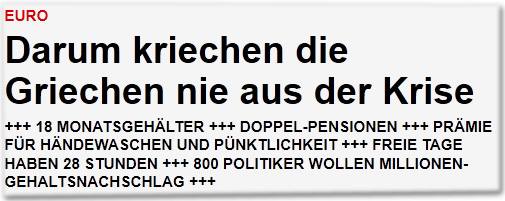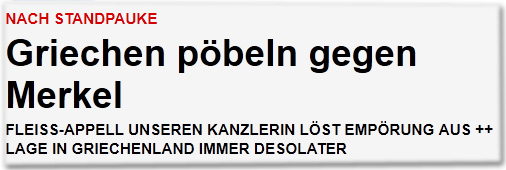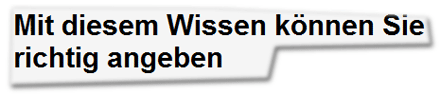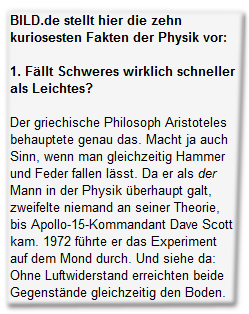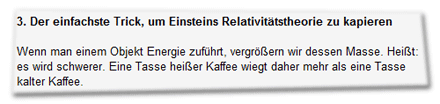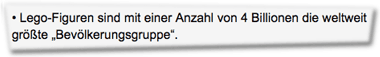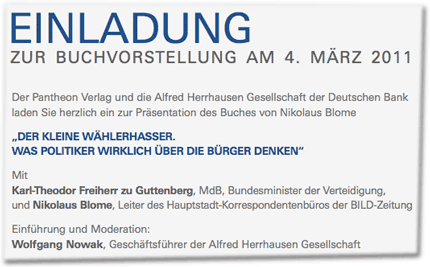— Ein Gastbeitrag von Anatol Stefanowitsch —
Bei der geballten und systematischen Bösartigkeit der Bildzeitung und ihrer Spin-offs mag es ein wenig kleinlich erscheinen, sich über ein eher randständiges Possenspiel aus Sprachnörgelei und Scheinheiligkeit aufzuregen, das BILD.de letzte Woche aufgeführt hat. Aber das Aufregen über Sprachnörgelei ist nun einmal Beruf und Berufung für mich, und die Scheinheiligkeit der BILD kann man nicht oft genug entblößen.
Worum geht es? Nun, BILD.de hat sich mit dem “Sprach-Trainer” Andreas Busch zusammengetan, um den Leser/innen eine Liste der “10 am häufigsten falsch verwendeten Wörter” zu präsentieren. Und das sind die 10 “fiesen Sprach-Fallen”, in absteigender Reihenfolge ihrer Fiesigkeit:
- Public Viewing (soll vermieden werden, da es angeblich nur “Leichenschau” bedeuten kann).
- Sympathie (soll nur in seiner “ursprünglichen” Bedeutung “Mitleid” verwendet werden).
- Busen (soll nur für seine angebliche Ursprungsbedeutung, “das Tal zwischen den Brüsten”, verwendet werden).
- Reifenwechsel (da wir das ganze Rad wechseln, sollen wir Radwechsel sagen).
- Kult (sollen wir nur in seiner ursprünglichen Bedeutung “religiöses Ritual” verwenden).
- für etwas sorgen (sollen wir nur mit der Bedeutung “sich um jemanden kümmern” verwenden).
- männliche Berufsbezeichnungen wie Arzt (sollen nur für Männer verwendet werden).
- verstorben (sollen wir nie verwenden, um über etwas zu reden, das den Verstorbenen zu Lebzeiten betraf).
- irritiert (sollen wir nur mit der ursprünglichen Bedeutung “gereizt” verwenden).
- wollen (sollen wir nicht in Sätzen wie “Ich wollte fragen, ob…” verwenden).
Wenn Sie sich über diese Liste wundern, vielleicht sogar zaghaft anzweifeln, dass es sich dabei überhaupt um “Sprach-Fallen” (geschweige denn um “fiese”) handelt, seien Sie beruhigt: Sie sind nicht allein. Tatsächlich will ich nicht verschweigen, dass mindestens neun dieser zehn Tipps kompletter Blödsinn und durch nichts zu rechtfertigen sind und getrost ignoriert werden können.
Aber hier soll es nicht darum gehen, ob diese Sprachtipps nützlich oder richtig sind. Stattdessen interessiert es mich, ob BILD.de in der Lage ist, sich wenigstens drei Tage lang selbst daran zu halten. Die Liste wurde am Mittag des 23. Mai 2011 veröffentlicht, der Suchraum ist also die Zeit bis zum 26. Mai 2011. Gehen wir die Liste also Wort für Wort durch.
Public Viewing. Es gab zwar Ausschreitungen im Umfeld des Spiels VfL Osnabrück–Dynamo Dresden am 24. Mai 2011, aber zu Tode gekommen ist glücklicherweise niemand. Warum also kündigt BILD.de Public Viewings an, nur einen Tag nachdem man die Leserschaft eindringlich davor gewarnt hat, das Wort für etwas anderes zu verwenden als für eine Leichenschau? Konnte man dieser fiesesten unter den “fiesen Sprach-Fallen” nicht ausweichen — schon allein, um ohnehin gewaltbereite Fußballfans nicht noch auf dumme Ideen zu bringen?
Sympathie. Ich will ehrlich sein: Auch ich bemitleide Menschen, die BILD.de lesen oder an Horoskope glauben, und mit Menschen, die an Horoskope glauben, die sie auf BILD.de gelesen haben, habe ich doppelt Mitleid. Aber ich habe das Gefühl, dass es in diesem Horoskop, das BILD.de am 25. Mai 2011, nur zwei Tage nach den tollen Sprach-Tipps von Busch, veröffentlicht hat, nicht um Mitleid geht sondern darum, dass man Zwillingen — nun ja, Sympathie entgegenbringt. War es zuviel verlangt, dieses immerhin doch am zweithäufigsten falsch verwendete Wort zu meiden und zu ersetzen durch — ja, was denn eigentlich?
Busen. Es ist sonst nicht mein Stil, über die sekundären Geschlechtsmerkmale mir nicht persönlich bekannter Damen zu sprechen, aber ich komme um den Hinweis nicht herum, dass in dieser informativen Bildergalerie vom 24. Mai 2011 eins nicht zu sehen ist: das “Tal” zwischen Lindsey Lohans Brüsten. Denn das verdeckt sie geistesgegenwärtig und gesittet. Was dagegen recht gut zu erkennen ist, sind die Brüste selbst — mit der Überschrift tappt BILD.de also direkt in “Sprach-Falle” Nr. 3.
Reifenwechsel. Über Wechsel von Rädern und Reifen schreibt BILD.de nur, wenn es entweder Zeit ist, Winter- oder Sommerreifen aufzuziehen oder in der Formel-1-Berichterstattung. In den drei Tagen nach der Veröffentlichung der “fiesen Sprach-Fallen” gab es keins von beidem, deshalb musste ich hier auf den Vortag, den 22. Mai 2011, zurückgreifen. Aber dafür bin ich mir zu einhundert Prozent sicher, dass bei Vettels angeblichen Reifenwechsel in Wahrheit die Räder gewechselt wurden: Wenn Vettels Mechaniker tatsächlich die Reifen neu aufgezogen hätten, hätte der Boxenstopp länger gedauert als das gesamte Rennen, und er hätte es nicht gewinnen können. Ich sage deshalb einfach mal “reingetappt” — wenn in der Berichterstattung über das Rennen von diesem Wochenende plötzlich von Radwechseln die Rede ist, nehme ich natürlich alles zurück.
Kult. Man kann schon den Eindruck bekommen, dass Jimmy Choo zusammen mit Manolo Blahnik und Christian Louboutin eine Art Dreifaltigkeit für Schuhfetischisten darstellen, aber wenn BILD.de Jimmy Choo in Überschrift und Teaser dieser Meldung vom Abend des 23. Mai 2011 gleich zwei Mal als Kult bezeichnet, geht es nicht um eine Verwendung überteuerter High Heels bei rituellen religiösen Handlungen — obwohl man doch nur wenige Stunden zuvor darauf gedrängt hat, das Wort nur zur Bezeichnung solcher Rituale zu verwenden. Im Spiel BILD.de gegen die “fiesen Sprach-Fallen” führen die Sprach-Fallen also mit 0:5.
Sorgen. “Mütter sorgen für Kinder, Lehrer für ihre Schüler, da stimmt das Verb”, erfahren wir aus den Sprachtipps von Sprechtrainer Busch, die BILD.de mahnend an uns weitergibt. Keinesfalls aber stimme es in Sätzen wie “Blitzeis sorgt für Verkehrschaos”, denn Blitzeis könne “für nichts und niemanden sorgen”. Chemikaliencocktails sind demnach in der Vorstellung von BILD.de offenbar eher so etwas wie Mütter, und Großeinsätze der Feuerwehr sind wie deren Kinder — anders lässt sich diese Schlagzeile vom 25. Mai 2011 nicht erklären. Oder ist man bei BILD.de trotz aller guten Vorsätze auch in die sechste “fiese Sprachfalle” getappt? Das ließe dann langsam Fahrlässigkeit vermuten.
Mann statt Frau. Man muss BILD.de zugestehen, dass man sich sehr konsequent an die Regel hält, für Männer die männliche und für Frauen die weibliche Berufsbezeichnung zu verwenden. Das eröffnet übrigens die Möglichkeit zu interessanten Untersuchungen über das dort gepflegte Geschlechterbild: Das Wort Arzt hat über 260 000 Treffer auf bild.de, das Wort Ärztin nur ca. 40 000. Das ist ein Zahlenverhältnis von etwa als 6:1, in der echten Welt kommen auf jede Ärztin aber nur zwei Ärzte. Aber ich schweife ab. BILD.de vergisst diese Regel in dem Moment, in dem man über gemischte Gruppen, z.B. von Ärztinnen und Ärzten, schreibt: Dann wird plötzlich nur noch die männliche Bezeichnung gewählt, wie in diesem Artikel vom 26. Mai 2011 (in dem noch dazu ausschließlich Männer erkrankt scheinen). So tappt man doch noch in die “fiese Sprach-Falle” Nr. 7.
Verstorben. “Frau Müller hat das Lebensmittelgeschäft mit ihrem verstorbenen Mann geführt” — die “fiese Sprach-Falle”, die Sprechtrainer Busch in diesem Satz ausgemacht hat, erklärt er wie folgt:
“Nein, das hat sie nicht. Das wäre ausgesprochen makaber. Natürlich hat sie das Geschäft mit ihrem LEBENDEN Mann geführt.” Man darf seinem Gegenüber anscheinend nicht zumuten, diesen offensichtlichen Schluss selbst zu ziehen. Warum, muss man sich dann fragen, mutet BILD.de seinen Leser/innen genau das in dieser Meldung vom 25. Mai 2011 zu, in der ein Rentner natürlich nicht auf einen Toten, sondern auf einen Lebenden geschossen hat, der erst als Folge dieser Schüsse verstarb?
Irritiert. Es kann sein, dass die Fahne, um die es in der folgenden Meldung, ebenfalls vom 24. Mai 2011, geht, den einen oder anderen gestört hat — der wäre dann irritiert im von Sprechtrainer Busch vorgeschlagenen Sinne gewesen. Aber die Mehrzahl war wohl irritiert in dem angeblich falschen und zu vermeidenden Sinne des Wortes — verwirrt, und ein wenig besorgt. Damit tappt BILD.de ist in die neunte der zehn “fiesen Sprachfallen”. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage: Das ist kein Zufall. Man nimmt die Sprachtipps von Sprach-Trainer Busch bei BILD.de gerade ernst genug, um die Leser/innen damit zu piesacken, aber keinesfalls ernst genug, um sich selbst daran zu halten (Parallelen im Umgang von BILD.de mit Fakten ganz allgemein mag jeder selbst ziehen, ich bin hier nur für Sprache zuständig).
Wollte. Das Ergebnis 9/10 reicht mir, meine Schlussfolgerung ist gezogen, mein Auftrag erfüllt. Die letzte “Sprach-Falle” bezieht sich auf ein Sprachmuster, das in journalistischen Texten sehr selten und wegen seiner Variabilität allgemein zu schwer zu suchen ist. Ich schenke BILD.de also diesen einen Punkt im sicheren Bewusstsein, dass sich mit etwas Mühe auch dafür ein Beispiel fände.
Wie alle anderen Sprachfallen existiert auch diese, wie eingangs angedeutet, ohnehin nur in den Köpfen von Sprach-Trainer Busch und BILD.de. Ich werde das im Laufe der Woche im Sprachlog für alle sprachlich Interessierten genauer zeigen. Los geht es mit Folge 1, in der es um sorgen, Kult und Busen geht.
Nachtrag, 5. Juni: Inzwischen hat Anatol Stefanowitsch auch Folge 2 und 3 online gestellt.