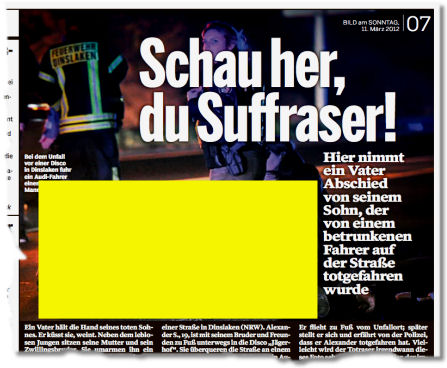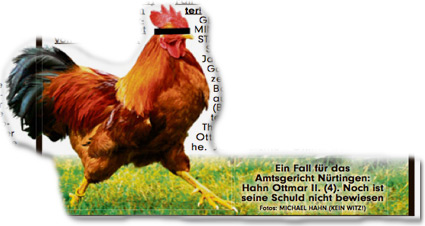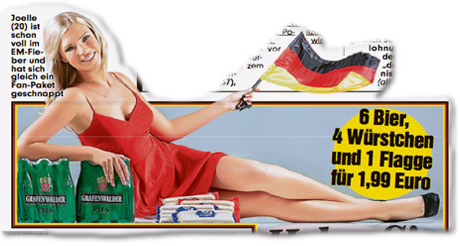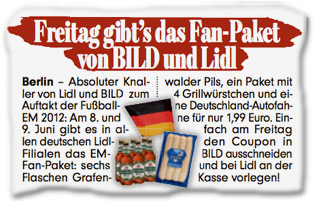Drei- bis viermal im Jahr laden die “Dresdner Neuesten Nachrichten” für einen Tag einen “Gast-Chefredakteur” ein, der gemeinsam mit der Redaktion eine Ausgabe mit einem thematischen Schwerpunkt entwickelt. Darauf ist der Chefredakteur der “Dresdner Neuesten Nachrichten” offenbar so stolz, dass er in einer Stellungnahme gegenüber dem Deutschen Presserat ausführlich über dieses Projekt referiert und auflistet, welche prominenten und nicht-prominenten “Gast-Chefredakteure” es schon gegeben habe und welche Themen diese dabei bearbeitet hätten.
Diese Stellungnahme war nötig geworden, weil sich ein Leser beim Presserat über die “DNN”-Ausgabe vom 15. Februar beschwert hatte, deren “Gast-Chefredakteur” Rolf Steinbronn, Vorstandsvorsitzender der Krankenkasse AOK Plus, war.
In seinem Leitartikel hatte Steinbronn erklärt, wie viel Geld die AOK Plus (die “größte gesetzliche Krankenkasse in Sachsen und Thüringen”) wofür ausgibt, und dass die AOK Plus allein im vergangenen Jahr 70 Millionen Euro durch Rabattvertäge mit Pharmafirmen gespart habe.
Und solche Einsparungen sind natürlich was Tolles für die Versicherten der AOK Plus:
Vom Spareffekt profitieren letztlich alle Versicherten, indem sie sich darauf verlassen können, bei der AOK Plus bis mindestens 2014 von Zusatzbeiträgen verschont zu bleiben.
Und was die AOK Plus sonst noch tolles macht, konnte der Leser fast überall in dieser Ausgabe der “DNN” erfahren:
- Im Lokalteil etwa kamen die Mitarbeiter eines Jugendgästehauses zu Wort, die dank der Gesundheitsförderung der Dresdner AOK jetzt drei Übungsstunden à 60 Minuten mit individuellen, arbeitsplatzbezogenen Rückenübungen bekommen haben.
- Im Kulturteil stand ein Artikel über ein Präventionsprojekt, bei dem Musiker des Landesjugendorchesters Sachsen spezielle Übungen zur Stärkung ihres Bewegungsapparats lernen sollten, um Haltungsschäden zu vermeiden. Gefördert von der AOK Plus, wie der Leser erfuhr.
- Und im Sportteil erschien ein Interview mit dem Leiter des Betriebssportvereins der AOK in Dresden, das “Entspannung bei Zumba in der Mittagspause” versprach. Man muss aber gar nicht bei der AOK arbeiten, um dort mitmachen zu dürfen: “Unser Sportverein richtet sich aber nicht nur an AOK-Mitarbeiter, sondern ist für alle offen.”
Der Beschwerdeführer fand insgesamt acht Artikel, in denen er das Gebot der klaren Trennung von Redaktion und Werbung verletzt sah.
Der Chefredakteur der “DNN”, Dirk Birgel, betonte in seiner Stellungnahme, dass die Veröffentlichung weder von dritter Seite bezahlt noch durch geldwerte Vorteile belohnt worden sei. Auch ein Kopplungsgeschäft liege nicht vor.
Die “DNN” beharrte auf ihre redaktionelle Unabhängigkeit: Nur der Leitartikel sei vom Chef der AOK Plus verfasst und durch den Chefredakteur selbst geprüft worden. Alle anderen Beiträge seien durch die Redaktion selbst erarbeitet worden. Es sei “naheliegend”, dass sie thematisch im Zusammenhang mit dem Gast-Chefredakteur stünden.
Wenn überhaupt, so der Chefredakteur, dann könnte allenfalls in der Mitteilung, dass die AOK bis 2014 keine Zusatzbeiträge erheben wolle, eine werbliche Wirkung gesehen werden. Er erklärte aber auch eindrucksvoll, warum das eigentlich nicht sein könne: Da die Meldung die überwiegende Anzahl der Leser betreffe, überlagere hier das öffentliche Interesse einen möglichen Werbeeffekt. Auch in allen anderen Artikeln überlagere der Informationswert eindeutig eine mögliche Werbewirkung für die AOK.
Einer der vom Leser kritisierten Artikel mit dem Titel “Last-Minute-Fitness für Wintersportler” gehöre übrigens gar nicht zu den mit dem AOK-Chef vorbereiteten Texten, führte der Chefredakteur weiter aus: Es handele sich dabei vielmehr um den vorletzten Teil der zwölfteiligen Serie “Gesund und aktiv”, die von der AOK lediglich durch die Schaltung einer Anzeige in Form eines Logos begleitet werde. Dieser Text sei aber auch keine AOK-Veröffentlichung, sondern ein von einem Facharzt für Orthopädie verfassten Beitrag zum Thema “Skilanglauf und Abfahrtski” ohne Bezug zur AOK. Auf der Seite finde sich zudem ein Interview mit einer Ernährungsberaterin, in dem der einzige Bezug zur AOK sei, dass diese bei der Krankenkasse arbeite.
Die “Maßnahmen” des Presserates:
Hat eine Zeitung, eine Zeitschrift oder ein dazugehöriger Internetauftritt gegen den Pressekodex verstoßen, kann der Presserat aussprechen:
- einen Hinweis
- eine Missbilligung
- eine Rüge.
Eine “Missbilligung” ist schlimmer als ein “Hinweis”, aber genauso folgenlos. Die schärfste Sanktion ist die “Rüge”. Gerügte Presseorgane werden in der Regel vom Presserat öffentlich gemacht. Rügen müssen in der Regel von den jeweiligen Medien veröffentlicht werden. Tun sie es nicht, dann tun sie es nicht.
Der Beschwerdeausschuss des Presserats konnte sich der Argumentation der “Dresdner Neuen Nachrichten” nicht anschließen und erkannte in der Berichterstattung eine Verletzung des Grundsatzes der klaren Trennung von Redaktion und Werbung. Die gemeinsam mit der AOK Plus entstandenen Beiträge überschritten die Grenze zwischen einer Berichterstattung von öffentlichem Interesse und Schleichwerbung nach Richtlinie 7.2 Pressekodex.
Die Häufung von Beiträgen, in denen über die Krankenkasse und ihr im Wettbewerb stehendes Angebot berichtet wird, sei redaktionell nicht mehr zu begründen. Es entstehe dabei eine Werbewirkung für die AOK, die nicht durch ein Leserinteresse an der Berichterstattung zu rechtfertigen ist.
Der Presserat sprach deshalb eine “Missbilligung” gegen die “Dresdner Neuesten Nachrichten” aus.