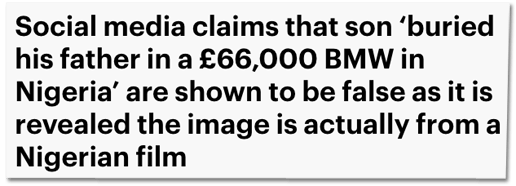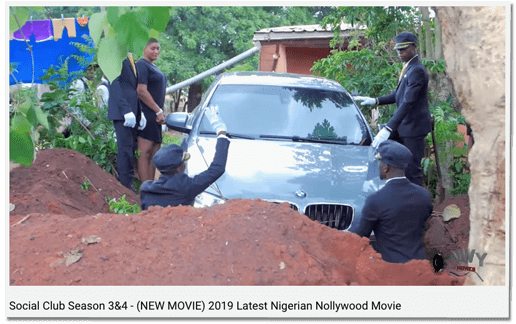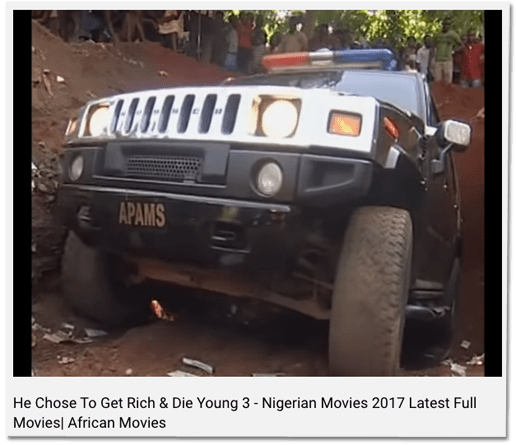1. Härter, härter, härter
(diekolumnisten.de, Heinrich Schmitz)
Der Jurist Heinrich Schmitz kommentiert die neue “Bild”-Kampagne für höhere Strafen bei Kindesmissbrauch und “Kinderpornographie”: “Wer den Missbrauch von Kindern verhindern will, muss früher ansetzen. Strafgesetze greifen immer erst, sobald eine Tat begangen wurde. Dann ist es zu spät. Aber – und das macht den großen Reiz von Gesetzesverschärfungen für Politiker aus – verschärfte Gesetze kosten nichts und lassen sich im Wahlkampf gut vermarkten. Das ist wohl der Hauptgrund, warum so gerne lautstark nach ihnen gerufen wird. Wirksame Maßnahmen hingegen sind teuer und unpopulär.”
2. Gesetz gegen Hasskriminalität im Netz soll verabschiedet werden
(spiegel.de, Frank Patalong)
Diese Woche stimmt der Bundestag über das “Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität” ab. Es gehe darum, die Identifizierung von Netz-Hetzern und -Hetzerinnen zu ermöglichen oder zu erleichtern sowie die Durchsetzbarkeit von Klagen zu verbessern. Der Gesetzesentwurf werde wahrscheinlich eine Mehrheit finden, doch es gebe auch Kritik an den neuen Bestimmungen, wie Frank Patalong erklärt.
3. Die ARD zeigt Chinas Kampf gegen Corona – wie China ihn sehen will
(uebermedien.de, Hinnerk Feldwisch-Drentrup)
Heute Abend um 22:45 Uhr strahlt das Erste die SWR-Doku “Die Story im Ersten: Wuhan – Chronik eines Ausbruchs” aus, zu der es bereits vor wenigen Tagen Kritik in der “SZ” gab. Bemängelt wurde zum Beispiel, dass die Filmproduktionsfirma nicht in China gewesen sei und stattdessen Material des chinesischen Propagandaapparats verarbeitet habe. Hinnerk Feldwisch-Drentrup hat den Fall für “Übermedien” nochmal gründlich aufgearbeitet: “Auch wenn der Sender sich ‘von Anfang an der nicht unheiklen Materiallage bewusst’ gewesen sei, wie ein Sprecher betont, übernimmt die Doku in weiten Strecken die Inszenierung der KP: Nach dieser kam in der Coronakrise die Wende, als die Zentralregierung in Peking ‘die Zügel’ in die Hand nahm. Dabei war Xi schon Anfang Januar über den Ausbruch informiert und damit befasst. Das lässt der Film aber ebenso unerwähnt wie viele andere Probleme aus der Frühphase der Pandemie.”
4. Markus Lanz im ZDF: Ein Moderator verblüfft mit gewaltiger Ignoranz
(fr.de, Daland Segler)
Daland Segler kritisiert den ZDF-Moderator Markus Lanz, den er für politisch voreingenommen hält: “Drei Dinge sollte mitbringen, wer als Gast zu einer Talkshow geht: Selbstbewusstsein, Kompetenz beim Thema und eine gewisse Dickfelligkeit. Wer sich von Markus Lanz einladen lässt, braucht allerdings noch etwas mehr: Ein gerüttelt Maß an Masochismus. Wobei: Das gilt vor allem für Menschen, die der Moderator (der keiner ist), verdächtigt, links zu sein.”
5. Verschwörungstheorien: Was gegen den Irrglauben hilft
(aerzteblatt.de, Alina Reichardt)
Alina Reichardt wendet sich mit ihrem Beitrag über Verschwörungserzählungen vornehmlich an Ärztinnen und Ärzte. Im medizinischen Alltag gebe es immer wieder Patientinnen und Patienten, die dem klassischen Gesundheitssystem und “der Schulmedizin” misstrauisch gegenüberständen, weil sie allerlei Mythen, Spekulationen und Verschwörungsideen aufsäßen. Der Artikel ist auch für medizinische Laien geeignet und kann dazu beitragen, die Gründe für derartige Verhaltens- und Denkmuster besser zu verstehen.
6. “Immer die gleiche Polizeiarbeit”
(taz.de, Erica Zingher)
Die “taz” hat sich mit der Kulturwissenschaftlerin und Literaturexpertin Sandra Beck über Krimis unterhalten. Wie wirken sich TV-Polizeiserien auf unser Verständnis von Wahrheit und Gerechtigkeit aus? Warum sind Polizeigewalt und Rassismus in Polizeiserien eher selten ein Thema? Und wie könnte eine neue Ethik des Erzählens im Krimi aussehen?