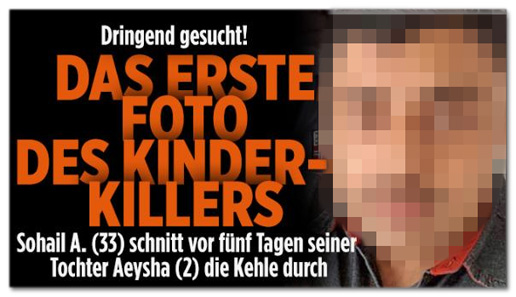1. Wie man die Amokfahrt von Münster mit dem IS in Verbindung bringt
(uebermedien.de, Katharina Wecker)
Die Journalistin Katharina Wecker bekommt eine Anfrage von der zweitgrößte Boulevardzeitung Großbritanniens, der „Daily Mail“: Ob sie die Online-Kollegen als sogenannte „Fixerin“ bei der Recherche zum Geschehen in Münster unterstützen könne? Sie sagt zu und erlebt, wie das recherchierte Material verdreht und falsch interpretiert wird, um einen Aufreger mit Verschwörungseinschlag zu produzieren: „Es war meine erste Zusammenarbeit mit „Mail Online“ und meine erste Tätigkeit als „Fixerin“. Es wird wahrscheinlich auch meine letzte sein. Nachdem ich den veröffentlichten Artikel gelesen und festgestellt habe, wie weit sich der Text teilweise von der Recherche entfernt hat, habe ich mich dazu entschlossen, auf mein Honorar zu verzichten und diesen Text zu schreiben.“
2. MDR will “vorsichtiger” mit dem “N-Wort” umgehen
(deutschlandradio.de, Sebastian Wellendorf, Audio, 4:48 Minuten)
Der MDR Sachsen hatte die Frage gestellt: “Darf man heute noch “Neger” sagen?” und dafür einen Shitstorm kassiert. Der “Deutschlandfunk” hat sich mit MDR-Radio-Sachsen-Chef Bernhard Holfeld über das Thema unterhalten. Das vierminütige Gespräch lohnt in zweierlei Hinsicht: Weil es einen Programmchef zeigt, der sich in alle Richtungen dreht und windet und nach Ausschlüpfen sucht, und mit Sebastian Wellendorf einen Journalisten, der ihm dies nicht durchgehen lässt.
3. Mord auf Malta
(projekte.sueddeutsche.de, Mauritius Much & Hannes Munzinger & Bastian Obermayer & Holger Stark & Fritz Zimmermann)
Im Oktober 2017 wurde die maltesische Investigativ-Journalistin Daphne Caruana Galizia durch ein Attentat mit einer Autobombe getötet. Nun arbeiten Reporter von 18 Medien wie der „New York Times“, des „Guardian“ oder „Le Monde“ zusammen daran, ihre Recherchen fortzusetzen und ihre Ermordung zu rekonstruieren. In Deutschland sind der Rechercheverbund aus „SZ“, „WDR“ und „NDR“ beteiligt die “Zeit” (Wer hat sie umgebracht?). Der Text zeichnet Daphne Caruana Galizias Leben auf der Insel nach und stellt die Frage nach den Hintermännern ihrer Ermordung.
Dazu ein TV-Tipp: Die „ARD“-Sendung Monitor widmet sich in ihrer heutigen Sendung dem Thema Mord auf Malta: Der Fall Caruana Galizia (“Das Erste”, 19.04.2018, 21:45 Uhr)
4. Tschüss Neon!
(zeit.de, Dirk Peitz)
Vor 15 Jahren erschien die erste Ausgabe des Monatsmagazins „Neon“, ein Heft “für junge Leserinnen und Leser, die schon lange volljährig sind, aber ihre jugendliche Unbeschwertheit bewahren wollen”. Nun ist es Zeit Abschied zu nehmen, jedenfalls von der gedruckten Ausgabe. „Neon“ wird nur noch digital weiterleben, wie Print-Chefredakteurin Ruth Fend in einem Abschiedsbrief bekannt machte. Dirk Peitz blickt bei “Zeit Online” auf die vergangenen Jahre zurück.
Auch der Rest der Branche kondoliert, zum Beispiel hier: Die Neon leuchtet nicht mehr (sueddeutsche.de, Karoline Meta Beisel) oder hier: Abschied vom Ich-Journalismus (spiegel.de, Eva Thöne)
5. Medienwächter: Bild macht Rundfunk!
(wuv.de, Petra Schwegler)
Die Kommission für Zulassung und Aufsicht „ZAK“ hat drei „Bild“-Live-Streams mit TV-Sendern gleichgestellt. Die Folge: “Springer” benötigt eine Sendelizenz! Dem widerspricht der Konzern: Es handele sich nicht um zulassungspflichtigen Rundfunk im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages. Amüsanter Nebenaspekt: Während die Verlage aufschreien, wenn Fernsehsender Textinhalte veröffentlichen und dies als Wildern in ihrem Revier beklagen, scheint dies umgekehrt nicht zu gelten. Jedenfalls nicht in diesem Fall.
6. Schöner Grüßen mit quoteSalute!
(dhd-blog.org, Stefan Dumontt & Frederike Neuber & Lou Klappenbach)
Ihnen sind die üblichen Grußformeln zu unpersönlich, primitiv und langweilig? Dann verabschieden Sie sich in der nächsten Mail doch einfach mal mit einem Textbaustein aus alten Zeiten. „quoteSalute“ hat Grußformeln aus verschiedenen frei verfügbaren historischen Briefeditionen zusammengetragen, die sich per Knopfdruck in die Zwischenablage kopieren lassen. In diesem Sinne empfehle ich mich mit der innigsten Ehrerbietung und Dankbarkeit als ihr gehorsamster Diener und 6-vor-9-Kurator Lorenz Meyer.