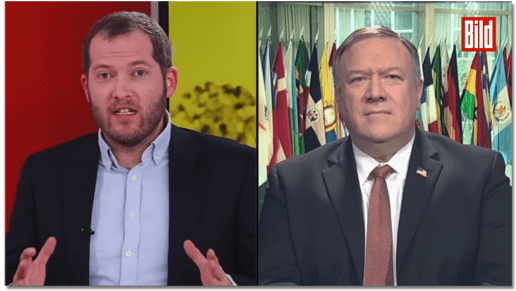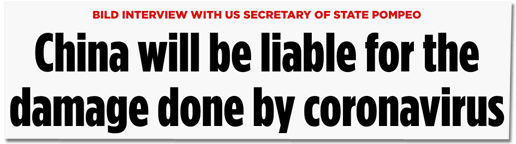1. Pandemie-Leugner Wodarg fordert 250.000 Euro von Volksverpetzer
(volksverpetzer.de, Thomas Laschyk)
Die Äußerungen von Wolfgang Wodarg zur COVID-19-Pandemie in Deutschland stoßen bei vielen Wissenschaftlern, Politikerinnen und Medien auf Kritik, so auch beim “Volksverpetzer”. Dagegen setzt sich Wodarg nun mit juristischen Mitteln zur Wehr und besteht laut “Volksverpetzer” nicht nur auf der Abgabe einer Unterlassungserklärung, sondern auch auf Zahlung von 250.000 Euro als angeblichen Schadensersatz. Der “Volksverpetzer” erfährt im Netz derweil eine große Welle der Solidarität.
2. Königlicher Badeurlaub ist kein zeitgeschichtliches Ereignis
(lto.de)
Das Landgericht Köln hat es der “Bild”-Redaktion per einstweiliger Verfügung verboten, Urlaubsfotos des niederländischen Königspaares zu veröffentlichen. Die Aufnahmen zeigen König Willem-Alexander und Königin Máxima in Badebekleidung bei einem Yachtausflug in Griechenland und waren offensichtlich mit einem Teleobjektiv geschossen worden. Der Springer-Verlag habe den Beschluss des Gerichts anerkannt. Ihm drohe im Wiederholungsfall ein Ordnungsgeld in Höhe von 250.000 Euro.
3. Die Liebe zu Fox News ist erkaltet – plant Trump jetzt einen eigenen TV-Sender?
(rnd.de, Imre Grimm)
Lange Zeit war Fox News Donald Trumps Haus- und Hofsender, doch seit einiger Zeit scheint die Liebe erkaltet. Nun hat ein Fox-Moderator die Übertragung einer Live-Pressekonferenz mit den Worten “Ich kann Ihnen das nicht weiter mit gutem Gewissen zeigen” abgebrochen. Imre Grimm kommentiert: “Es scheint, als habe der Sender plötzlich eine menschliche Regung entdeckt, die lange überlagert schien von der gierigen Begeisterung über Trumps quotenträchtige Qualitäten als Entertainer und Menschenfänger: das eigene Gewissen.” Nun würden sich einige Beobachter fragen, ob Trump einen eigenen Sender starten wolle.
4. So niedrig ist der Anteil der Frauen in Berichten von Spiegel, Focus, Bild am Sonntag und Welt am Sonntag
(kress.de, Roland Schatz)
Media Tenor, ein Schweizer Unternehmen für Medienanalysen, hat untersucht, wie oft in den vergangenen zehn Jahren in großen Medien wie “Spiegel”, “Focus”, “Bild am Sonntag” und “Welt am Sonntag” über Männer und Frauen geschrieben wurde. Was den Anteil von Frauen in der Berichterstattung betrifft, kommt besonders der “Spiegel” schlecht weg: “Beim Spiegel dominiert also die Einstellung: In erster Linie lohnt es sich über Tätigkeiten von Männern zu berichten, wenn sie ihre Leserschaft über Entwicklungen in Politik und Wirtschaft informieren. 2020 wird seit 2001 das extremste Jahr: in den letzten 20 Jahren spielten Frauen für die Hamburger nie eine unwichtigere Rolle als in diesen Covid19-Zeiten.”
5. Gericht weist Klage gegen Falschmeldung der Polizei ab
(netzpolitik.org, Marie Bröckling)
Im Jahr 2017 twitterte die Polizei im Zusammenhang mit der Räumung des linksalternativen Kiezladens Friedel54, dass im Gebäude ein Türknauf unter Strom gesetzt worden sei. Die Meldung verbreitete sich sehr schnell, auch aufgrund der Berichterstattung einiger Medien, stellte sich jedoch später als Falschmeldung heraus. Nun musste sich ein Gericht mit dem Vorgang befassen. Es hat die Klage der Betroffenen jedoch abgewiesen. Der Richter habe Verständnis für den Wunsch der Kläger, ein Grundsatzurteil zum Twittern der Polizei zu erwirken. Es sei jedoch der “richtige Fall zum falschen Zeitpunkt”.
6. Zwei Mal «Streaming» – oder: Die Renaissance der Programmzeitschrift
(medienwoche.ch, Nick Lüthi)
Die Idee einer Streaming-Programmzeitschrift erinnert ein wenig an die guten alten Zeiten, in denen man im Buchhandel noch gedruckte Internet-Adresslisten kaufen konnte. Nick Lüthi hat sich zwei Streaming-Magazine für den deutschen beziehungsweise den Schweizer Markt angeschaut.
Weiterer Lesehinweis: Während die klassischen TV-Sender mit ihren Mediatheken immer mehr zu einer Art Gegen-Netflix werden wollen, testet der Streaming-Anbieter in Frankreich ein lineares Programm, das für alle gleich ist: Man nannte es Glotze (sueddeutsche.de, Claudia Tieschky).