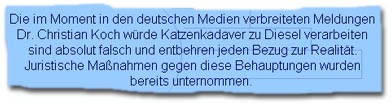1. “Beispiellose Veränderung seit 2012”
(taz.de)
Laut einem aktuellen Bericht der UNESCO sei die weltweite Meinungs- und Pressefreiheit seit 2012 so massiv eingebrochen wie selten zuvor in der Geschichte. Verantwortlich für diesen historischen Rückgang seien neben politischem Druck und dem Aufstieg autoritärer Regime vor allem die Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz sowie die Jagd nach Klickzahlen. Trotz der alarmierenden Lage gebe es Hoffnung durch engagierten investigativen Journalismus und grenzüberschreitende Kooperationen.
2. Neue Spionage-Software entdeckt
(netzpolitik.org, Martin Schwarzbeck)
Die Organisation Reporter ohne Grenzen habe eine Spionage-Software identifiziert, die der belarussische Geheimdienst KGB vermutlich seit Jahren gezielt gegen Journalistinnen und Journalisten einsetze. Die Installation erfolge dabei nicht über technische Sicherheitslücken, sondern durch physischen Zugriff auf das entsperrte Gerät, etwa wenn dieses bei Verhören abgegeben werden muss.
3. Amazon darf Prime-Video-Kunden keine Werbung aufzwängen
(lto.de)
Das Landgericht München habe entschieden, dass Amazon bestehende Verträge für das Streamingangebot Prime Video nicht einseitig ändern und plötzlich Werbung schalten dürfe. Nach Auffassung der Richter hätten die Kundinnen und Kunden ein werbefreies Angebot gebucht. Weder Gesetze noch die Nutzungsbedingungen würden eine solche Verschlechterung erlauben. Das Unternehmen müsse die Betroffenen nun über die Unzulässigkeit informieren. Amazon habe allerdings bereits angekündigt, gegen das noch nicht rechtskräftige Urteil vorzugehen.
4. TV-Vermarkter steuern auf schwachen Jahresabschluss zu
(dwdl.de, Timo Niemeier)
Die Bruttowerbeeinnahmen der Fernsehsender seien im November deutlich gesunken, wobei vor allem RTL und ProSieben starke Verluste hinnehmen müssten. Dieser Abwärtstrend belaste den gesamten Werbemarkt, auch wenn Zeitungen und Außenwerbung Zuwächse verzeichnet hätten. Lediglich die Kinowerbung habe dank neuer Blockbuster ihren bisher besten Monat des Jahres erlebt.
5. Konstruktiv statt kontrovers bei Miosga
(verdi.de, Volker Nünning)
Der Programmausschuss des NDR habe das Konzept der Sendung “Caren Miosga” als “richtig und erfolgreich” bewertet, da der Fokus statt auf Konfrontation auf konstruktiven und vertiefenden Gesprächen liege. Die Prüfer hätten jedoch angemerkt, dass die langen Einzelinterviews zu Beginn bisweilen die Redezeit der anderen Gäste verkürzen würden. Im linearen Fernsehen sei “Caren Miosga” die meistgesehene politische Talkshow in Deutschland.
6. Buchtipps für den Einstieg in den Journalismus
(netzwerkrecherche.org, Flora Boehlke)
Flora Boehlke liefert eine Liste mit Buchtipps, die Interessierten den Einstieg in den Journalismus erleichtern können. Die Empfehlungen umfassen sowohl theoretische Grundlagenwerke als auch Fachliteratur zu speziellen Bereichen wie dem Daten- und dem Investigativjournalismus. Außerdem gibt es zwei Empfehlungen mit spannenden Fallgeschichten, die anhand berühmter Recherchen einen praktischen Einblick in die journalistische Arbeit geben.